Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Wie konnte ein Mehrheitsbeschluss über Mülltonnen ungültig sein?
- Welchen Plan fasste die Eigentümergemeinschaft ursprünglich?
- Warum wich der spätere Beschlussvorschlag vom ursprünglichen Plan ab?
- Worin bestand der Kern des juristischen Streits?
- War die Klage überhaupt zulässig?
- Wann ist ein Beschluss per E-Mail ausnahmsweise mit Mehrheit gültig?
- Warum war die Abweichung bei der Mülltonne entscheidend für das Urteil?
- Wie hat das Gericht also entschieden?
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Was ist ein Umlaufbeschluss und welche Zustimmung ist dafür grundsätzlich erforderlich?
- Unter welchen Voraussetzungen kann in einer Gemeinschaft von der Einstimmigkeit bei Abstimmungen außerhalb von Versammlungen abgewichen werden?
- Welche rechtlichen Konsequenzen hat es, wenn ein Beschluss von der ursprünglichen Ermächtigung abweicht?
- Warum ist die präzise Formulierung von Beschlussgegenständen in Vollmachten oder Ermächtigungen so wichtig?
- Wann ist ein Beschluss in einer Wohnungseigentümergemeinschaft unwirksam und wie sollte man reagieren, wenn man die Gültigkeit anzweifelt?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 215 C 57/24 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Amtsgericht Köln
- Datum: 14.04.2025
- Aktenzeichen: 215 C 57/24
- Verfahren: Anfechtung eines Eigentümerbeschlusses
- Rechtsbereiche: Wohnungseigentumsrecht (Regeln für Eigentümergemeinschaften und deren Beschlüsse)
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Eigentümer einer Wohnungseinheit in einer Wohnanlage. Sie wollten einen per E-Mail gefassten Beschluss ihrer Eigentümergemeinschaft für ungültig erklären lassen.
- Beklagte: Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, der die Kläger angehören. Sie verteidigte die Gültigkeit des Beschlusses.
Worum ging es genau?
- Sachverhalt: Eine Eigentümergemeinschaft wollte neue Müllcontainer bestellen und hatte eine Abstimmung per Umlaufbeschluss beschlossen. Weil die ursprünglich geplante Größe eines Containers nicht lieferbar war, wich der tatsächliche Umlaufbeschluss davon ab und sah eine kleinere Tonne vor. Dieser geänderte Beschluss wurde nur mit Mehrheit, nicht einstimmig, gefasst.
Welche Rechtsfrage war entscheidend?
- Kernfrage: Darf ein Beschluss der Wohnungseigentümer, der außerhalb einer Versammlung (im Umlaufverfahren) gefasst wurde, gültig sein, wenn er vom ursprünglich geplanten Inhalt abweicht und nicht alle Eigentümer zugestimmt haben?
Wie hat das Gericht entschieden?
- Klage stattgegeben: Der Beschluss der Eigentümergemeinschaft wurde für ungültig erklärt.
- Kernaussagen der Begründung:
- Grundsätzlich müssen alle Wohnungseigentümer einem Beschluss zustimmen, der außerhalb einer Versammlung (im Umlaufverfahren) gefasst wird.
- Eine Eigentümerversammlung kann zwar vorab beschließen, dass ein ganz bestimmter Punkt später im Umlaufverfahren auch mit einfacher Mehrheit entschieden werden darf.
- Im vorliegenden Fall wich der später im Umlaufverfahren gefasste Beschluss jedoch wesentlich von dem Inhalt ab, der ursprünglich zur Abstimmung per Mehrheit freigegeben worden war; es war „etwas anderes“ und nicht nur eine kleine Änderung.
- Da der Beschluss wesentlich abwich, galt wieder die Regel der vollständigen Zustimmung, die hier fehlte, und der Beschluss war somit ungültig.
- Folgen für die Beklagte:
- Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer muss den Beschluss als ungültig behandeln, die neuen Müllcontainer dürfen also auf dieser Grundlage nicht bestellt werden.
- Sie muss außerdem die Kosten des Rechtsstreits tragen.
Der Fall vor Gericht
Wie konnte ein Mehrheitsbeschluss über Mülltonnen ungültig sein?
In einer Kölner Wohnungseigentümergemeinschaft schien die Sache klar: Die meisten Eigentümer hatten sich für die Anschaffung neuer Müllcontainer ausgesprochen. Der Beschluss wurde per E-Mail gefasst und verkündet. Doch ein Ehepaar, das mit Nein gestimmt hatte, zog vor Gericht und bekam Recht. Das Amtsgericht Köln erklärte den Mehrheitsbeschluss für ungültig. Diese Entscheidung wirft ein Schlaglicht auf eine entscheidende Frage im Wohnungseigentumsrecht: Wie viel Spielraum gibt es, wenn eine Gemeinschaft eine Entscheidung trifft, die vom ursprünglichen Plan abweicht? Die Antwort des Gerichts ist eine Lektion in juristischer Präzision und zeigt, warum manchmal selbst eine klare Mehrheit nicht ausreicht.
Welchen Plan fasste die Eigentümergemeinschaft ursprünglich?
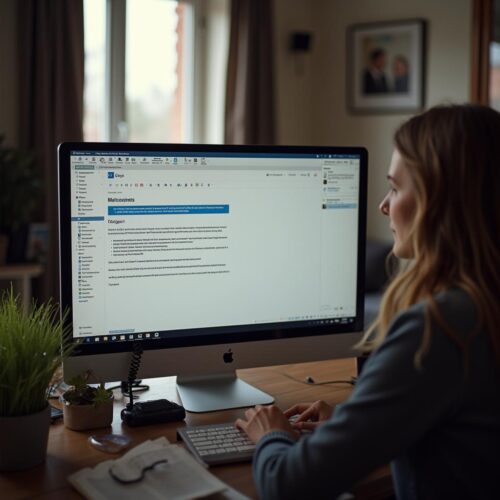
Alles begann in einer Eigentümerversammlung am 14. Oktober 2024. Auf der Tagesordnung stand die leidige Müllfrage. Die Gemeinschaft wollte die Entsorgungssituation verbessern und beschloss, über die Anschaffung von drei großen Containern abzustimmen – jeweils 770 Liter fassend für Restmüll, Papier und Wertstoffe.
Normalerweise müssen Beschlüsse, die nicht in einer Versammlung, sondern schriftlich oder per E-Mail gefasst werden, einstimmig sein. Juristen nennen das ein Umlaufverfahren, eine Abstimmung, die ohne ein physisches Treffen „im Umlauf“ bei allen Eigentümern stattfindet. Das Gesetz verlangt hierfür grundsätzlich die Zustimmung aller Eigentümer. Das soll sicherstellen, dass niemand übergangen wird, wenn es keine Möglichkeit zur gemeinsamen Diskussion gibt.
Die Gemeinschaft wollte diese hohe Hürde umgehen. Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) erlaubt hierfür einen Kniff: Die Eigentümer können in einer Versammlung beschließen, dass für einen ganz bestimmten, einzelnen Sachverhalt im Umlaufverfahren eine einfache Mehrheit ausreicht. Diesen Beschluss, der die Anforderung von Einstimmigkeit auf Mehrheit senkt, nennt man Absenkungsbeschluss. Genau das tat die Gemeinschaft in Köln: Sie beschloss, dass über den Kauf der „3 Container á 770 Liter“ per Mehrheit im Umlaufverfahren entschieden werden darf. Der Weg für eine schnelle und unkomplizierte Entscheidung schien geebnet.
Warum wich der spätere Beschlussvorschlag vom ursprünglichen Plan ab?
Nach der Versammlung machte sich die Hausverwalterin an die Arbeit, das Umlaufverfahren in die Wege zu leiten. Doch sie stieß auf ein unerwartetes praktisches Problem: Eine Wertstofftonne mit 770 Litern Fassungsvermögen, wie sie im Absenkungsbeschluss stand, war beim örtlichen Entsorger schlichtweg nicht erhältlich. Die verfügbaren Größen waren entweder deutlich kleiner (240 Liter) oder größer (1.100 Liter).
Anstatt die Eigentümergemeinschaft erneut zu befragen oder eine neue Versammlung einzuberufen, formulierte die Verwalterin den Beschlussantrag für das Umlaufverfahren eigenständig um. Der neue Vorschlag lautete nun: Die Gemeinschaft bestellt zwei 770-Liter-Container für Restmüll und Papier und zusätzlich eine weitere Wertstofftonne mit nur 240 Litern. Dieser Vorschlag wurde den Eigentümern zur Abstimmung per E-Mail vorgelegt. Er wurde mit Mehrheit angenommen; nur das klagende Ehepaar stimmte dagegen. Am 10. Dezember 2024 verkündete die Verwalterin das Ergebnis.
Worin bestand der Kern des juristischen Streits?
Das klagende Ehepaar war der Ansicht, dass dieser Mehrheitsbeschluss nicht gültig sein konnte. Ihre Argumentation war einfach und direkt: Der Absenkungsbeschluss aus der Versammlung hatte die Erlaubnis für eine Mehrheitsentscheidung an eine klare Bedingung geknüpft – die Abstimmung über exakt „3 Container á 770 Liter“. Da der tatsächliche Beschluss nun aber von einer 240-Liter-Wertstofftonne sprach, sei er inhaltlich nicht mehr von der ursprünglichen Erlaubnis gedeckt. Folglich, so die Kläger, hätte die allgemeine Regel gegolten: Ein Umlaufbeschluss braucht die Zustimmung aller. Da sie mit Nein gestimmt hatten, fehle diese Einstimmigkeit und der Beschluss sei ungültig.
Die beklagte Eigentümergemeinschaft sah das anders. Sie hielt den Beschluss für rechtmäßig, da er ihrer Meinung nach durch den Absenkungsbeschluss legitimiert war. Die Abweichung sei eine notwendige Anpassung an die Realität gewesen und habe am Kern der Sache – der Neuorganisation der Müllentsorgung – nichts geändert.
War die Klage überhaupt zulässig?
Bevor das Gericht sich dem inhaltlichen Streit widmen konnte, musste es eine prozessuale Hürde klären. Das Ehepaar hatte seine Klage zunächst falsch formuliert und erst später präzisiert, dass es den finalen Umlaufbeschluss vom 10. Dezember anfechten wollte. Das Gesetz erlaubt eine solche Klageänderung, wenn das Gericht sie für „sachdienlich“ hält. Das bedeutet, die Änderung muss dazu dienen, den Streit zwischen den Parteien endgültig und effizient zu klären. Das Gericht sah diese Bedingung als erfüllt an. Die Änderung brachte den wahren Kern des Konflikts auf den Tisch und verhinderte, dass ein neuer, separater Prozess geführt werden musste. Die Klage war also zulässig.
Wann ist ein Beschluss per E-Mail ausnahmsweise mit Mehrheit gültig?
Das Gericht stellte die zentrale Rechtsfrage in den Mittelpunkt: Unter welchen Umständen darf von der strengen Regel der Einstimmigkeit im Umlaufverfahren abgewichen werden? Die Antwort liegt im Zusammenspiel zweier Vorschriften. Grundsätzlich gilt: keine Versammlung, keine Diskussion, daher muss jeder zustimmen.
Der Absenkungsbeschluss ist die bewusste Ausnahme von dieser Regel. Man kann ihn sich wie einen Blankoscheck vorstellen, den die Gemeinschaft ausstellt. Dieser Scheck ist aber nicht für beliebige Ausgaben gültig, sondern für einen ganz konkreten Verwendungszweck, der klar darauf vermerkt ist. Die Gemeinschaft sagt quasi: „Für den Kauf von Gegenstand X darf die Verwalterin mit einer Mehrheitsentscheidung bezahlen.“
Die entscheidende Frage für das Gericht war also: War der tatsächlich getätigte „Kauf“ – also der Beschluss über die 240-Liter-Tonne – noch vom Verwendungszweck auf dem „Scheck“ gedeckt? Oder wurde hier etwas ganz anderes gekauft, für das die Vollmacht nicht galt?
Warum war die Abweichung bei der Mülltonne entscheidend für das Urteil?
Das Gericht kam zu einem klaren Ergebnis: Der gefasste Beschluss wurde nicht mehr vom ursprünglichen Absenkungsbeschluss „getragen“. Die Richter stellten fest, dass die Erlaubnis zur Mehrheitsentscheidung an einen ganz konkreten Beschlussgegenstand gebunden war: drei Tonnen à 770 Liter. Als sich herausstellte, dass dies nicht möglich war, hätte die Sache neu bewertet werden müssen.
Der von der Verwalterin formulierte neue Vorschlag war nämlich nicht einfach nur eine kleine Anpassung. Er stellte die Eigentümer vor eine völlig neue Wahl, die in der Versammlung nie diskutiert worden war. Plötzlich standen Optionen im Raum wie: Behalten wir die alte 240-Liter-Tonne und stellen eine weitere dazu? Oder geben wir die alten Tonnen zurück und schaffen eine große 1.100-Liter-Tonne an? Der schließlich zur Abstimmung gestellte Beschluss – die Anschaffung einer zusätzlichen 240-Liter-Tonne – war nur eine dieser möglichen Varianten.
Das Gericht argumentierte, dass eine Auslegung des Absenkungsbeschlusses, die der Verwalterin erlaubt hätte, nach eigenem Ermessen eine dieser neuen Varianten auszuwählen und zur Abstimmung zu stellen, „fernliege“. Die Eigentümer hatten nie die Gelegenheit, über die Vor- und Nachteile der neuen Situation zu debattieren. Die Entscheidung für eine 240-Liter-Tonne war nicht einfach nur ein „Weniger“ (Minus) im Vergleich zur 770-Liter-Tonne, sondern etwas grundlegend „Anderes“ (ein Aliud).
Die logische Kette des Gerichts war damit geschlossen:
- Der Grundsatz: Für einen Umlaufbeschluss ist Einstimmigkeit erforderlich.
- Die Ausnahme: Ein Absenkungsbeschluss kann für einen bestimmten Gegenstand eine Mehrheitsentscheidung erlauben.
- Die Abweichung: Der Gegenstand, über den abgestimmt wurde (2x770L + 1x240L), war ein anderer als der, für den die Ausnahme galt (3x770L).
- Die Konsequenz: Die Ausnahmeregelung griff nicht. Daher galt wieder der Grundsatz der Einstimmigkeit.
Wie hat das Gericht also entschieden?
Da das klagende Ehepaar mit Nein gestimmt hatte, war die erforderliche Einstimmigkeit nicht erreicht. Aus diesem Grund erklärte das Amtsgericht Köln den per E-Mail gefassten Beschluss für ungültig. Die beklagte Eigentümergemeinschaft muss nun die Kosten des gesamten Rechtsstreits tragen. Die Entscheidung zeigt, dass formale Regeln im Wohnungseigentumsrecht keine bloßen Schikanen sind. Sie dienen dem Schutz der einzelnen Eigentümer und stellen sicher, dass Entscheidungen, insbesondere wenn sie ohne offene Aussprache getroffen werden, auf einer klaren und unmissverständlichen Grundlage beruhen.
Die Schlüsselerkenntnisse
Ein Absenkungsbeschluss erlaubt Mehrheitsentscheidungen im Umlaufverfahren nur für exakt den definierten Beschlussgegenstand – weicht die spätere Abstimmung davon ab, greift wieder die strenge Einstimmigkeitsregel.
- Präzision schlägt praktische Vernunft: Ein Absenkungsbeschluss, der Mehrheitsentscheidungen für „3 Container á 770 Liter“ erlaubt, deckt nicht automatisch die Anschaffung von Containern anderer Größen ab, auch wenn diese aus praktischen Gründen notwendig wird.
- Eigenständige Umformulierung zerstört die Legitimation: Verwaltungen dürfen Beschlussvorschläge nicht nach eigenem Ermessen an veränderte Umstände anpassen, wenn dadurch ein inhaltlich neuer Gegenstand entsteht, über den die Gemeinschaft nie diskutiert hat.
- Klageänderungen erleichtern die Streitbeilegung: Gerichte lassen nachträgliche Präzisierungen der Klage zu, wenn diese den wahren Konflikt zwischen den Parteien auf den Tisch bringen und separate Verfahren vermeiden.
Formale Regeln im Wohnungseigentumsrecht schützen Minderheitenrechte durch strikte Bindung an den ursprünglich beschlossenen Gegenstand – selbst scheinbar geringfügige Abweichungen können eine Mehrheitsberechtigung zunichte machen.
Stehen Sie vor der Frage, ob ein im Umlaufverfahren gefasster Beschluss Ihrer Eigentümergemeinschaft aufgrund von Abweichungen gültig ist? Lassen Sie die Wirksamkeit eines solchen Beschlusses in einer unverbindlichen Ersteinschätzung prüfen.)
Unsere Einordnung aus der Praxis
Aus unserer Sicht sendet dieses Urteil ein unmissverständliches Signal an alle Verwalter und Wohnungseigentümergemeinschaften. Es stellt klar, dass ein Absenkungsbeschluss für das Umlaufverfahren kein Blankoscheck ist: Selbst scheinbar geringfügige, aber inhaltliche Abweichungen vom exakt definierten Beschlussgegenstand lassen die Erlaubnis zur Mehrheitsentscheidung sofort entfallen. Dies erzwingt eine bemerkenswerte Präzision bei der Formulierung von Beschlussanträgen und legt den Finger in die Wunde vermeintlich praktischer Anpassungen. Für die WEG-Praxis bedeutet das: Bei jeder materiellen Änderung des Sachverhalts ist eine erneute Beschlussfassung – notfalls in einer Versammlung – unumgänglich, um Anfechtungsrisiken zu minimieren und teure Prozesskosten zu vermeiden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist ein Umlaufbeschluss und welche Zustimmung ist dafür grundsätzlich erforderlich?
Ein Umlaufbeschluss ist eine Entscheidung, die Eigentümer einer Gemeinschaft nicht in einer Versammlung, sondern auf anderem Wege, zum Beispiel schriftlich oder per E-Mail, treffen. Grundsätzlich muss jeder einzelne Eigentümer diesem Beschluss zustimmen.
Stell dir das vor wie bei einer wichtigen Gruppenentscheidung, die getroffen wird, ohne dass sich alle zusammensetzen und miteinander sprechen können. Wenn ihr keine gemeinsame Diskussion habt, müssen wirklich alle mit dem Vorschlag einverstanden sein, damit er gültig ist und niemand sich übergangen fühlt.
Diese Art der Abstimmung wird auch Umlaufverfahren genannt. Weil es dabei kein physisches Treffen und somit keine Möglichkeit zur gemeinsamen Diskussion und Meinungsbildung gibt, verlangt das Gesetz in der Regel die Zustimmung aller Eigentümer. Dies schützt jeden Einzelnen davor, dass Entscheidungen über seinen Kopf hinweg getroffen werden, wenn er keine Gelegenheit hatte, seine Meinung vorzubringen oder Fragen zu stellen.
Diese strenge Regelung schützt das Vertrauen in faire und umfassend getragene Entscheidungen, die außerhalb einer direkten Zusammenkunft gefasst werden.
Unter welchen Voraussetzungen kann in einer Gemeinschaft von der Einstimmigkeit bei Abstimmungen außerhalb von Versammlungen abgewichen werden?
In einer Gemeinschaft können Sie die Einstimmigkeit für Abstimmungen, die nicht in einer Versammlung stattfinden, nur dann umgehen, wenn Sie dies vorher in einer regulären Versammlung explizit beschließen. Dieser sogenannte „Absenkungsbeschluss“ gilt aber immer nur für einen ganz bestimmten, einzelnen Sachverhalt.
Stellen Sie sich diesen Beschluss wie einen speziell ausgefüllten Blankoscheck vor: Sie können ihn ausstellen, damit jemand für einen ganz konkreten Zweck (z.B. den „Kauf von drei bestimmten Mülltonnen“) Geld abheben kann, aber nicht für beliebige Ausgaben oder andere Dinge.
Normalerweise müssen Entscheidungen, die schriftlich oder per E-Mail getroffen werden – Juristen nennen das ein Umlaufverfahren – einstimmig sein. Das bedeutet, wirklich alle Eigentümer müssen zustimmen, damit niemand übergangen wird, da es keine gemeinsame Diskussion gab. Der Absenkungsbeschluss ist eine bewusste Ausnahme von dieser strengen Regel. Er erlaubt der Gemeinschaft, für eine spezifische Angelegenheit im Umlaufverfahren eine einfache Mehrheit ausreichen zu lassen. Dies lockert die übliche Sicherheitsvorkehrung der Einstimmigkeit, um effizienter entscheiden zu können.
Diese Regelung schützt die einzelnen Eigentümer und sorgt dafür, dass auch Beschlüsse, die ohne gemeinsame Aussprache gefasst werden, auf einer klaren und unmissverständlichen Grundlage basieren.
Welche rechtlichen Konsequenzen hat es, wenn ein Beschluss von der ursprünglichen Ermächtigung abweicht?
Weicht ein Beschluss inhaltlich von der ursprünglichen Erlaubnis ab, ist er in der Regel nicht mehr gültig. Dann gilt die eigentliche Grundregel wieder, die oft strengere Voraussetzungen vorsieht, wie etwa die Zustimmung aller Beteiligten.
Stellen Sie sich eine Vollmacht oder einen Blankoscheck vor, den Sie für einen ganz konkreten Zweck ausstellen. Dieser Scheck ist nur für genau das gültig, was darauf vermerkt ist. Kauft jemand damit etwas anderes, ist der Scheck ungültig und die erteilte Erlaubnis nicht mehr anwendbar.
Im Kontext von Abstimmungen bedeutet das: Wenn eine Gemeinschaft die Möglichkeit nutzt, eine strenge Abstimmungsregel – wie die Einstimmigkeit im schriftlichen Verfahren – durch eine lockerere (zum Beispiel die einfache Mehrheit) zu ersetzen, muss sie den genauen Gegenstand dieser Ausnahme präzise festlegen. Das Gericht bezeichnet dies als „Absenkungsbeschluss“. Weicht der später gefasste Beschluss inhaltlich von diesem ursprünglich definierten Gegenstand ab, ist die Erlaubnis zur Mehrheitsentscheidung hinfällig. Die ursprünglich strengere Grundregel, die beispielsweise die Zustimmung aller Beteiligten verlangt, kommt dann wieder zum Tragen.
Diese Regel stellt sicher, dass alle Beteiligten genau wissen, worüber sie abstimmen und dass niemand unbemerkt vor vollendeten Tatsachen steht.
Warum ist die präzise Formulierung von Beschlussgegenständen in Vollmachten oder Ermächtigungen so wichtig?
Die präzise Formulierung von Beschlussgegenständen in Vollmachten oder Ermächtigungen ist sehr wichtig, weil sie Rechtssicherheit schafft und Missverständnisse sowie Interpretationsspielräume vermeidet. Nur wenn der konkrete Inhalt einer Entscheidung exakt beschrieben ist, kann sie auch später gültig sein.
Stell dir vor, du gibst jemandem einen Scheck, der nur für den Kauf eines ganz bestimmten Artikels gültig ist, beispielsweise für „drei 770-Liter-Müllcontainer“. Wenn die Person dann aber nur zwei 770-Liter-Container und zusätzlich eine 240-Liter-Tonne kauft, ist die Bezahlung mit deinem Scheck nicht mehr gedeckt. Die Ermächtigung galt nur für das, was ganz genau festgelegt wurde.
Ein Gericht prüft exakt, ob der tatsächlich umgesetzte Beschlussinhalt noch dem entspricht, wozu die Erlaubnis ursprünglich erteilt wurde. Eine Erlaubnis zum Kauf von „drei 770-Liter-Müllcontainern“ deckt nur genau diese Gegenstände ab. Eine Änderung, die zum Beispiel eine kleinere Tonne vorsieht, macht den Beschluss zu etwas grundlegend „Anderem“. Ähnlich oder „nahe dran“ reicht hier nicht aus.
Diese strenge Vorgabe schützt jeden Einzelnen und gewährleistet, dass Entscheidungen, besonders wenn sie ohne direkte Diskussion zustande kommen, immer auf einer klaren und unmissverständlichen Basis stehen.
Wann ist ein Beschluss in einer Wohnungseigentümergemeinschaft unwirksam und wie sollte man reagieren, wenn man die Gültigkeit anzweifelt?
Ein Beschluss Ihrer Wohnungseigentümergemeinschaft ist dann unwirksam, wenn er entweder von Anfang an ungültig (Nichtig) war oder wenn ein Gericht ihn wegen eines Fehlers aufhebt. Das größte Risiko für Sie als Eigentümer besteht darin, einen nur anfechtbaren Beschluss für von vornherein nichtig zu halten und dadurch die entscheidende Klagefrist zu verpassen.
Stellen Sie sich das wie einen Strafzettel vor: Ein anfechtbarer Beschluss ist wie ein Strafzettel, den Sie erhalten. Er ist gültig und Sie müssen ihn bezahlen, es sei denn, Sie legen erfolgreich Einspruch ein. Ein nichtiger Beschluss ist wie ein Strafzettel, der versehentlich an die falsche Person geschickt wurde – er war von Anfang an gegenstandslos und musste nie bezahlt werden.
Anfechtbar bedeutet also: Der Beschluss gilt zunächst, auch wenn er fehlerhaft ist. Nur wenn Sie ihn innerhalb einer Frist gerichtlich anfechten, kann ein Gericht ihn für ungültig erklären. War der Beschluss hingegen nichtig, war er nie gültig und hat auch keine Wirkung. Ein Beschluss ist oft nichtig, wenn er eine Regel verletzt, die das Gesetz zwingend vorschreibt, oder wenn der Gegenstand des Beschlusses grundlegend anders ist als das, worüber die Gemeinschaft abstimmen durfte. Im Fall der Mülltonnen in Köln war es so: Die Gemeinschaft stimmte über andere Behälter ab, als sie es zuvor für eine Mehrheitsentscheidung freigegeben hatte. Deshalb fehlte die notwendige Einstimmigkeit, und der Beschluss war von Anfang an ungültig.
Wenn Sie die Gültigkeit eines Beschlusses anzweifeln, prüfen Sie immer schnell, ob es sich um einen anfechtbaren oder nichtigen Beschluss handelt. Vor allem bei anfechtbaren Beschlüssen gilt eine eiserne Frist von einem Monat für die Anfechtungsklage, die beginnt, sobald der Beschluss bekanntgegeben wurde. Untätigkeit führt dazu, dass der fehlerhafte Beschluss für immer gültig wird. Diese Frist schützt die Rechtssicherheit und Ihr Vertrauen in die getroffenen Entscheidungen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Absenkungsbeschluss
Ein Absenkungsbeschluss ermöglicht es einer Eigentümergemeinschaft, die normalerweise erforderliche Einstimmigkeit für Umlaufverfahren auf eine einfache Mehrheit zu reduzieren. Dieser Beschluss muss in einer regulären Versammlung gefasst werden und gilt nur für einen ganz bestimmten, einzelnen Sachverhalt. Das Wohnungseigentumsgesetz erlaubt diesen Weg, um Entscheidungen effizienter treffen zu können, ohne jedes Mal alle Eigentümer einzeln überzeugen zu müssen.
Beispiel: Die Kölner Eigentümergemeinschaft beschloss in ihrer Versammlung, dass über den Kauf der „3 Container á 770 Liter“ per Mehrheit im Umlaufverfahren entschieden werden darf, anstatt dass alle Eigentümer zustimmen müssen.
Klageänderung
Eine Klageänderung erlaubt es einem Kläger, während eines laufenden Gerichtsverfahrens seinen ursprünglichen Antrag zu präzisieren oder zu korrigieren. Das Gericht muss diese Änderung aber für „sachdienlich“ halten, das heißt, sie muss dazu beitragen, den Streit zwischen den Parteien endgültig und effizient zu klären. Diese Möglichkeit verhindert, dass wegen kleiner Formulierungsfehler gleich ein komplett neues Verfahren gestartet werden muss.
Beispiel: Das klagende Ehepaar hatte seine Klage zunächst falsch formuliert und später präzisiert, dass es den finalen Umlaufbeschluss vom 10. Dezember anfechten wollte. Das Gericht erlaubte diese Änderung, weil sie den wahren Kern des Konflikts auf den Tisch brachte.
Nichtig
Ein nichtiger Beschluss war von Anfang an ungültig und hat daher nie eine rechtliche Wirkung entfaltet. Anders als bei einem nur anfechtbaren Beschluss müssen Sie hier keine Frist beachten – der Beschluss ist und bleibt wirkungslos. Nichtigkeit tritt oft ein, wenn grundlegende gesetzliche Vorschriften verletzt wurden oder der Beschlussgegenstand völlig anders war als das, worüber eigentlich abgestimmt werden durfte.
Beispiel: Der Mülltonnen-Beschluss war nichtig, weil die Eigentümer über etwas anderes abstimmten (2x770L + 1x240L), als der Absenkungsbeschluss erlaubte (3x770L). Dadurch fehlte die erforderliche Einstimmigkeit für das Umlaufverfahren.
Umlaufverfahren
Ein Umlaufverfahren ist eine Abstimmung, die ohne physisches Treffen „im Umlauf“ bei allen Eigentümern stattfindet, zum Beispiel schriftlich oder per E-Mail. Das Gesetz verlangt hierfür grundsätzlich die Zustimmung aller Eigentümer, weil es keine Möglichkeit zur gemeinsamen Diskussion gibt. Diese strenge Regel soll sicherstellen, dass niemand übergangen wird, wenn wichtige Entscheidungen ohne offene Aussprache getroffen werden.
Beispiel: Die Kölner Eigentümergemeinschaft wollte über die Müllcontainer per E-Mail abstimmen, anstatt eine neue Versammlung einzuberufen. Für ein solches Umlaufverfahren hätte normalerweise jeder Eigentümer zustimmen müssen.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- Umlaufbeschluss und Einstimmigkeitsprinzip (§ 23 Abs. 3 Satz 2 WEG)
- KERNAUSSAGE: Ein Beschluss der Wohnungseigentümer, der nicht in einer Versammlung, sondern beispielsweise per E-Mail gefasst wird (Umlaufbeschluss), ist grundsätzlich nur gültig, wenn alle Eigentümer ihm zustimmen.
- → Bedeutung im vorliegenden Fall: Dies ist die Ausgangsregel im Wohnungseigentumsrecht für Entscheidungen außerhalb von Versammlungen. Da der Mülltonnen-Beschluss per E-Mail und nicht einstimmig gefasst wurde, war er nur gültig, wenn die Ausnahme des Absenkungsbeschlusses zutraf; andernfalls war er aufgrund der fehlenden Einstimmigkeit ungültig.
- Absenkungsbeschluss (§ 23 Abs. 3 Satz 3 WEG)
- KERNAUSSAGE: Eine Eigentümergemeinschaft kann in einer Versammlung beschließen, dass für einen ganz bestimmten, einzelnen Sachverhalt ein Umlaufbeschluss ausnahmsweise auch mit einfacher Mehrheit gültig ist, statt der sonst erforderlichen Einstimmigkeit.
- → Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Eigentümergemeinschaft in Köln hatte einen solchen Absenkungsbeschluss gefasst, der für den Kauf von „3 Containern á 770 Liter“ eine Mehrheitsentscheidung im Umlaufverfahren erlaubte. Dies war der Versuch, die strenge Einstimmigkeitsregel für diesen konkreten Fall zu umgehen und eine schnellere Entscheidung zu ermöglichen.
- Bindung des Absenkungsbeschlusses an den konkreten Gegenstand (Auslegung von Beschlüssen)
- KERNAUSSAGE: Die Erlaubnis, einen Umlaufbeschluss mit einfacher Mehrheit zu fassen, ist immer streng an den genau bezeichneten Sachverhalt gebunden, der im Absenkungsbeschluss festgelegt wurde.
- → Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht entschied, dass der tatsächlich gefasste Beschluss (2x 770L-Tonnen + 1x 240L-Tonne) wesentlich von dem ursprünglich erlaubten Gegenstand (3x 770L-Tonnen) abwich. Diese Abweichung war so erheblich, dass der Absenkungsbeschluss seine Gültigkeit verlor und die ursprüngliche Einstimmigkeit für den Umlaufbeschluss wieder galt, welche nicht erreicht wurde.
Das vorliegende Urteil
AG Köln – Az.: 215 C 57/24 – Urteil vom 14.04.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.



