Seit Jahren kämpfte eine Bewohnerin in Norddeutschland erbittert um das Einfamilienhaus, das sie als ihren Lebensmittelpunkt sah. Nachdem der Eigentümer das Haus wegen Eigenbedarfs für seine Tochter zurückforderte, wurde der ursprüngliche Mieter gerichtlich zur Räumung verurteilt. Die Bewohnerin versuchte daraufhin vehement, die Räumungsfrist zu verlängern und ihre angeblichen Mieterrechte durchzusetzen. Doch trotz einer vom Amtsgericht gewährten Frist bis März 2025 pochte der Eigentümer auf die schnelle Rückgabe seines Hauses – und das Landgericht lehnte ihre weiteren Anträge ab.
Übersicht
- Das Urteil in 30 Sekunden
- Die Fakten im Blick
- Der Fall vor Gericht
- Wie eine Familie um ihr Zuhause kämpfte – und welche Grenzen das Gesetz zieht
- Was war der Kern des Streits um das Einfamilienhaus?
- Wie beurteilte das Amtsgericht die Lage für die Bewohnerin?
- Welche Rettungsanker versuchte die Bewohnerin vor dem Landgericht zu werfen?
- Konnte die Bewohnerin eine längere Räumungsfrist erzwingen?
- War ein weiterer Schutz vor der Zwangsvollstreckung möglich?
- Warum sahen die Richter keine Chance für die Berufung der Bewohnerin?
- Wichtigste Erkenntnisse
- Benötigen Sie Hilfe?
- Das Urteil in der Praxis
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Welche rechtliche Stellung haben Personen, die in einer Mietwohnung leben, aber nicht selbst Mietvertragspartei sind?
- Unter welchen Umständen kann ein Mieter eine Räumungsfristverlängerung wegen unzumutbarer Härte beantragen?
- Was müssen Mieter tun und nachweisen, um eine Verlängerung der Räumungsfrist erfolgreich zu beantragen?
- Wann kann ein Gericht die Zwangsvollstreckung aus einem Räumungsurteil vorübergehend einstellen?
- Wer ist für die Unterbringung von Personen zuständig, die nach einer Räumung obdachlos werden könnten?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 6 S 8/25 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Urteil in 30 Sekunden
- Das Problem: ❓ Ein Vermieter wollte sein Haus zurückhaben. Die Tochter des ursprünglichen Mieters wollte nicht ausziehen.
- Die Frage: ⚖️ Musste die Tochter das Haus räumen oder konnte sie den Auszug verhindern?
- Die Antwort: Nein. Das Gericht entschied, dass sie ausziehen musste. Ihr Vater hatte die Kündigung bereits akzeptiert, und sie hatte keinen eigenen Mietvertrag.
- Das bedeutet das für Sie: Ihr Wohnrecht hängt stark von Ihrem Mietvertrag ab. Eine persönliche Notlage reicht selten aus, einen rechtmäßigen Auszug dauerhaft zu verhindern.
Die Fakten im Blick
- Gericht: Landgericht Lüneburg
- Datum: 25.03.2025
- Aktenzeichen: 6 S 8/25
- Verfahren: Berufungsverfahren
- Rechtsbereiche: Mietrecht, Zivilprozessrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Der Vermieter eines Einfamilienhauses. Er forderte die Räumung des Hauses aufgrund Eigenbedarfs für seine Tochter.
- Beklagte: Die Tochter des ursprünglichen Mieters, die das Haus bewohnte. Sie wehrte sich gegen die Räumung und forderte unter anderem, selbst als Mieterin anerkannt zu werden und die Zwangsräumung zu stoppen.
Worum ging es genau?
- Ein Vermieter wollte ein Haus für Eigenbedarf räumen lassen. Der ursprüngliche Mieter stimmte der Räumung zu, aber dessen Tochter weigerte sich auszuziehen.
Welche Rechtsfrage war entscheidend?
- Kann jemand eine gerichtlich angeordnete Frist zum Auszug verlängern oder die Zwangsräumung stoppen, wenn sie keine direkte Mieterin war und viele Verfahrensfehler behauptet?
Entscheidung des Gerichts:
- Urteil im Ergebnis: Die Anträge der Beklagten auf Räumungsschutz wurden abgewiesen.
- Zentrale Begründung: Das Gericht wies die Anträge ab, da die Beklagte keine Mieterin war und ihr Aufenthaltsrecht mit der bereits rechtskräftigen Anerkennung der Räumung durch den Hauptmieter endete.
- Konsequenzen für die Parteien: Die Beklagte muss das Haus wie ursprünglich gerichtlich angeordnet räumen und eine korrekte Wohnanschrift angeben.
Der Fall vor Gericht
Wie eine Familie um ihr Zuhause kämpfte – und welche Grenzen das Gesetz zieht
In einer norddeutschen Stadt bahnte sich über Jahre ein tiefgreifender Streit um ein Einfamilienhaus an. Auf der einen Seite stand der Eigentümer und Vermieter, der sein Haus zurückhaben wollte. Auf der anderen Seite die Bewohner, allen voran die Tochter des ursprünglichen Mieters, die das Zuhause als ihren Lebensmittelpunkt betrachtete und sich mit aller Kraft gegen den Auszug wehrte. Dieser Fall beleuchtet die komplexen Spielregeln des Mietrechts und zeigt, wann die Gerichte dem Wunsch nach einer längeren Räumungsfrist oder gar einem Stopp der Zwangsvollstreckung Grenzen setzen müssen.
Was war der Kern des Streits um das Einfamilienhaus?
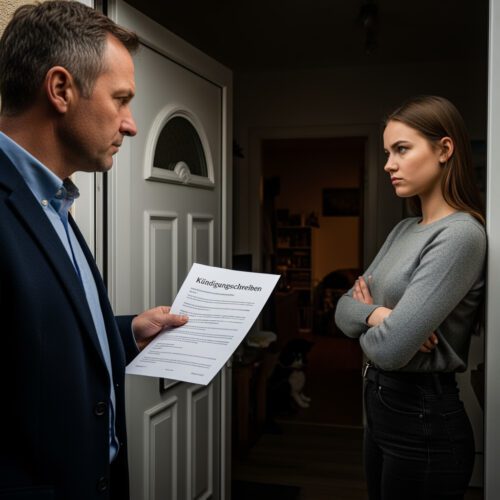
Die Geschichte beginnt im April 2016, als der Vermieter ein Einfamilienhaus an den Vater der späteren Hauptprotagonistin vermietete. Obwohl der Mietvertrag ausschließlich mit dem Vater geschlossen wurde, sah eine zusätzliche Vereinbarung vor, dass die Tochter das Haus ebenfalls bewohnen durfte. Jahrelang lebten sie dort, bis der Vermieter das Mietverhältnis im Februar 2022 wegen Eigenbedarfs für seine eigene Tochter kündigte. Er verlangte die Räumung des Hauses bis Ende August desselben Jahres.
Die Tochter widersprach der Kündigung im Namen ihres Vaters und behauptete, eine Vollmacht zu besitzen. Doch der Vater erkannte den Anspruch des Vermieters später gerichtlich an, was zu einem rechtskräftigen Urteil führte: Er musste das Haus räumen. Da die Tochter jedoch weiterhin dort wohnte, forderte der Vermieter auch von ihr die Räumung.
Die Tochter wiederum sah die Dinge ganz anders. Sie behauptete, selbst Mieterin des Hauses zu sein und nicht nur als „Gast“ ihres Vaters dort zu leben. Sie meinte, der Eigenbedarf des Vermieters sei nur vorgeschoben. Darum erhob sie eine umfangreiche Klage gegen den Vermieter und forderte unter anderem, das Mietverhältnis mit ihr selbst fortzusetzen und ihr sogar einen Anspruch auf eine sichere Unterbringung für sich und ihre zahlreichen Haustiere zuzusprechen. Sie wollte feststellen lassen, dass ihr vom Vermieter nie gekündigt worden war und die Eigenbedarfskündigung des Vermieters unwirksam sei.
Wie beurteilte das Amtsgericht die Lage für die Bewohnerin?
Die erste Instanz, das zuständige Amtsgericht, verurteilte die Bewohnerin antragsgemäß zur Räumung und gestand ihr eine letzte Gnadenfrist bis Ende März 2025 zu. Zugleich wies das Gericht sämtliche Klagepunkte der Bewohnerin ab. Die Richter waren überzeugt, dass die Tochter des ursprünglichen Mieters keine eigene Mietpartei war. Ihr Recht, das Haus zu bewohnen, leitete sich allein von ihrem Vater ab. Da das Mietverhältnis mit dem Vater durch dessen Anerkenntnis des Räumungsanspruchs beendet war, musste auch die Tochter das Haus verlassen. Das Gericht befand zudem, dass die Eigenbedarfskündigung des Vermieters rechtens war. Alle Einwände der Bewohnerin, einschließlich ihrer umfassenden Rügen gegen die Prozessführung des Gerichts – etwa wegen angeblicher Befangenheit des Richters oder fehlerhafter Zustellungen – wies das Amtsgericht zurück.
Welche Rettungsanker versuchte die Bewohnerin vor dem Landgericht zu werfen?
Die Bewohnerin gab sich mit diesem Urteil nicht zufrieden und legte Berufung ein. Ihre Hauptargumente waren eine angebliche unzumutbare Härte bei einer sofortigen Räumung, da sie keine Ersatzwohnung gefunden habe und ihre zahlreichen Haustiere in Gefahr wären. Sie erhob den Einwand, dass die Klage des Vermieters rechtsmissbräuchlich sei, weil der Eigenbedarf nur vorgetäuscht sei und ihr daraus ein Schadensersatzanspruch zustehe.
Darüber hinaus wiederholte und erweiterte sie ihre schwerwiegenden Vorwürfe gegen das Amtsgericht. Sie rügte Formfehler bei Zustellungen, Verstöße gegen das Prinzip des gesetzlichen Richters und beanstandete, dass der Richter über eigene Befangenheitsanträge entschieden habe, obwohl dies verfassungswidrig sei. Angesichts dieser vermeintlichen Missstände bat sie das Landgericht darum, die Räumungsfrist zu verlängern oder die Zwangsvollstreckung aus dem Räumungsurteil einstweilen einzustellen. Der Vermieter hingegen forderte die schnelle Durchsetzung des Räumungsurteils, da der Rechtsstreit bereits viel zu lange andauere.
Konnte die Bewohnerin eine längere Räumungsfrist erzwingen?
Das Landgericht, das nun über die Berufung entscheiden musste, prüfte zunächst den Antrag der Bewohnerin auf Verlängerung der Räumungsfrist. Obwohl das Amtsgericht ihr bereits eine solche Frist bis zum 31. März 2025 gewährt hatte, konnte eine Verlängerung nur erfolgen, wenn die Bewohnerin hinreichend nachgewiesen hätte, dass sie sich ernsthaft und intensiv um eine neue Wohnung bemüht hat, aber trotz aller Anstrengungen keine finden konnte. Genau das konnte die Bewohnerin aber nicht darlegen. Ihr fehlten konkrete Beweise wie Aufzeichnungen über Wohnungsbesichtigungen, Absagen oder die genauen Gründe des Scheiterns.
Das Gericht sah auch keine „besondere, unverhältnismäßige Härte“, die eine weitere Verzögerung der Räumung gerechtfertigt hätte. Die Richter betonten, dass die Bewohnerin, wie bereits das Amtsgericht festgestellt hatte, keine Vertragspartei des Mietvertrages war. Das bedeutete, dass ihr aus der Räumung weder direkte Schadensersatzansprüche noch ein Recht auf erneute Inbesitznahme des Hauses zustanden. Auch die Furcht vor Obdachlosigkeit konnte die Verlängerung nicht begründen. Das Landgericht stellte klar, dass die Aufgabe der Obdachlosenfürsorge bei den zuständigen Ordnungsbehörden liegt und nicht dem Vermieter aufgebürdet werden kann. Selbst die von der Bewohnerin behauptete Gefährdung ihrer Tiere wurde vom Gericht als nicht ausreichend detailliert und als kein Grund für eine weitere Verzögerung der Räumung angesehen.
War ein weiterer Schutz vor der Zwangsvollstreckung möglich?
Neben der Verlängerung der Räumungsfrist beantragte die Bewohnerin auch einen generellen Schutz vor der Zwangsvollstreckung sowie deren vorübergehende Einstellung. Diesen Antrag auf Vollstreckungsschutz wies das Landgericht aus zwei Gründen zurück. Erstens sah sich das Landgericht gar nicht als zuständiges Gericht für einen solchen Antrag an – dafür wäre das sogenannte Vollstreckungsgericht zuständig gewesen. Zweitens hätte der Antrag selbst bei Zuständigkeit keine Aussicht auf Erfolg gehabt. Die Gerichte sehen eine derartige Notlage, die ein Stoppen der Vollstreckung rechtfertigen würde, nur in absoluten Ausnahmefällen, etwa wenn das Leben oder die Gesundheit des Schuldners ernsthaft gefährdet wäre. Das Fehlen einer Ersatzwohnung oder die Aussicht auf ein Obdachlosenheim stellen in der Regel keine derart schwerwiegende Härte dar. Das Gericht betonte hierbei das verfassungsrechtlich geschützte Recht des Vermieters, seinen Anspruch auf Rückgabe seines Eigentums durchzusetzen.
Der Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung, den das Berufungsgericht selbst prüfen durfte, wurde ebenfalls abgelehnt. Der Grund hierfür war entscheidend: Die Berufung der Bewohnerin hatte nach Ansicht der Richter keine hinreichende Erfolgsaussicht.
Warum sahen die Richter keine Chance für die Berufung der Bewohnerin?
Das Landgericht schloss sich der Argumentation des Amtsgerichts an und legte detailliert dar, warum die Berufung der Bewohnerin scheitern musste. Der entscheidende Punkt war, dass das Mietverhältnis mit dem Vater der Bewohnerin spätestens mit dessen gerichtlichem Anerkenntnis des Räumungsanspruchs beendet war. Es spielte daher keine Rolle mehr, ob der Eigenbedarf des Vermieters nun tatsächlich vorlag oder nur vorgetäuscht war – das Mietverhältnis war durch das Anerkenntnis des Mieters wirksam beendet worden.
Die Richter verwiesen darauf, dass die Rechtmäßigkeit dieses Anerkenntnisurteils und die ordnungsgemäße Vertretung des Vaters bereits in vorherigen, rechtskräftigen Beschlüssen höherer Gerichte bestätigt worden waren. Da die Bewohnerin ihr Recht, das Haus zu nutzen, allein von ihrem Vater ableitete, war sie mit der Beendigung seines Mietvertrages ebenfalls zur Räumung verpflichtet. Sie konnte nicht beweisen, dass sie einen eigenen Mietvertrag mit dem Vermieter geschlossen hatte – eine Behauptung, die das Gericht als unglaubwürdig einstufte. Folglich hatte das Amtsgericht auch ihre umfassende Gegenklage zu Recht abgewiesen.
Die vielen Verfahrensrügen der Bewohnerin, die sich unter anderem auf angebliche Befangenheit des Richters oder fehlerhafte Zustellungen bezogen, wies das Landgericht ebenfalls als unbegründet zurück. Die Richter erklärten, dass die von der Bewohnerin gerügten Mängel entweder bereits in früheren, rechtskräftigen Entscheidungen als unbegründet zurückgewiesen worden waren oder, falls ein Befangenheitsantrag tatsächlich zu einem Handlungsverbot für den Richter hätte führen können, dieser Fehler geheilt war, da sich die Anträge später als unbegründet erwiesen hatten.
Zuletzt betonte das Gericht, dass die Fortsetzung des Rechtsstreits und eine weitere Verzögerung der Räumung für den Vermieter unzumutbar seien. Der Fall zog sich bereits seit dem Herbst 2022 hin, das Räumungsurteil gegen den Mieter lag bereits seit April 2023 vor, und das Urteil gegen die Bewohnerin seit Januar 2025. Die zahlreichen Anträge der Bewohnerin wurden als reine Verzögerungstaktik gewertet, die keine materiellen Erfolgsaussichten hatten.
Das Landgericht wies daher alle Anträge der Bewohnerin auf Vollstreckungsschutz und Verlängerung der Räumungsfrist ab. Als letzte Anweisung forderte das Gericht die Bewohnerin auf, binnen einer Woche eine korrekte und ladungsfähige Adresse mitzuteilen, da die bisherige Angabe einer Rechtsanwaltsadresse nicht ausreichte.
Wichtigste Erkenntnisse
Gerichte wägen die Schutzbedürfnisse von Bewohnern sorgfältig ab, setzen jedoch klare Grenzen, wenn Eigentumsrechte und Prozessökonomie im Vordergrund stehen.
- Abhängiges Wohnrecht: Bewohnt eine Person eine Immobilie ohne eigenen Mietvertrag, leitet sich ihr Aufenthaltsrecht vollständig vom Hauptmieter ab und endet, sobald dessen Mietverhältnis rechtlich beendet ist.
- Strenge Hürden für Fristverlängerung: Eine Räumungsfrist verlängert sich nur, wenn Betroffene nachweisen, dass sie sich intensiv und erfolglos um eine Ersatzwohnung bemüht haben; bloße Behauptungen oder die Aussicht auf Obdachlosigkeit reichen dafür nicht aus.
- Schutz vor Vollstreckung nur im Ausnahmefall: Gerichte gewähren Schutz vor Zwangsvollstreckung nur bei extremer Notlage wie Lebensgefahr; zudem erkennen sie wiederholte, substanzlose Verfahrensrügen als missbräuchliche Prozessverzögerung.
Das Gesetz schützt das Eigentum und sorgt für eine effiziente Rechtsdurchsetzung, auch wenn dies für Einzelne Härten bedeutet.
Benötigen Sie Hilfe?
Steht Ihnen eine Räumung bevor, obwohl Sie nicht der Hauptmieter sind? Finden Sie eine erste Orientierung: Fordern Sie Ihre unverbindliche Ersteinschätzung an.
Das Urteil in der Praxis
Für jeden, der sich auf Mietrechtssachen einlässt, sollte dieses Urteil ab sofort zur Pflichtlektüre gehören. Es verdeutlicht unmissverständlich, dass der rechtliche Status eines Bewohners über alles entscheidet und weder emotionaler Druck noch eine Flut von Verfahrensrügen die klare Rechtslage beugen können. Die Gerichte zogen hier konsequent eine rote Linie: Wer kein Vertragspartner ist, leitet seine Rechte vom Hauptmieter ab – und diese enden, wenn dessen Mietverhältnis durch ein rechtskräftiges Anerkenntnis erlischt, ungeachtet späterer Einwände zum Eigenbedarf. Die beharrliche Abweisung der Befangenheitsanträge und die klare Zuordnung der Obdachlosenfürsorge zur öffentlichen Hand zeigen zudem, dass die Geduld der Justiz mit reinen Verzögerungstaktiken endlich ist. Ein harter, aber wichtiger Mahnruf für alle, die glauben, ein rechtskräftiges Urteil ließe sich mit formalen Winkelzügen dauerhaft aushebeln.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welche rechtliche Stellung haben Personen, die in einer Mietwohnung leben, aber nicht selbst Mietvertragspartei sind?
Personen, die in einer Mietwohnung leben, aber keinen eigenen Mietvertrag mit dem Vermieter geschlossen haben, leiten ihr Wohnrecht vom Hauptmieter ab. Dies bedeutet, dass ihr Recht, die Wohnung zu nutzen, eng an den Mietvertrag des Hauptmieters gebunden ist. Endet der Mietvertrag des Hauptmieters, zum Beispiel durch eine Kündigung, verlieren auch alle anderen Mitbewohner ohne eigenen Vertrag ihr Recht, die Wohnung zu nutzen.
Man kann sich das so vorstellen: Ein Untermieter kann nur so lange in einer Wohnung bleiben, wie der Hauptmieter dort wohnen darf und sein eigener Mietvertrag besteht. Sobald der Hauptmietvertrag endet, verliert auch der Untermieter sein Recht, die Wohnung zu bewohnen, selbst wenn er persönlich keine Schuld an der Beendigung trägt.
Die Gerichte bestätigen diese Rechtsauffassung konsequent. Sie sehen eine Person ohne eigenen Mietvertrag nicht als eigenständige Mietpartei an. Dadurch stehen der Person auch keine direkten Ansprüche gegenüber dem Vermieter zu, etwa auf Schadensersatz oder auf die weitere Nutzung der Wohnung. Es spielt dann keine Rolle mehr, ob zum Beispiel eine Eigenbedarfskündigung des Vermieters berechtigt war, wenn der Hauptmietvertrag auf andere Weise beendet wurde. Um ein eigenständiges Wohnrecht zu besitzen, muss man einen eigenen, schriftlichen Mietvertrag mit dem Vermieter haben. Ohne diesen fehlt eine rechtliche Grundlage für ein unabhängiges Wohnrecht.
Diese Regelung stellt klare Verhältnisse zwischen Vermietern und Mietern her und schützt das verfassungsrechtlich geschützte Recht des Eigentümers, über sein Eigentum zu verfügen.
Unter welchen Umständen kann ein Mieter eine Räumungsfristverlängerung wegen unzumutbarer Härte beantragen?
Eine Verlängerung der Räumungsfrist aufgrund unzumutbarer Härte ist eine absolute Ausnahme und unterliegt strengen Voraussetzungen. Es ist vergleichbar mit einer Notbremse in einem Zug: Man zieht sie nur in absoluten Gefahrensituationen, nicht lediglich, weil man seinen Zielbahnhof verpasst hat.
Gerichte erkennen eine solche Härte nur in absoluten Ausnahmefällen an, beispielsweise wenn die Räumung das Leben oder die Gesundheit der betroffenen Person ernsthaft gefährden würde. Das bloße Fehlen einer Ersatzwohnung oder die Aussicht auf ein Obdachlosenheim reichen in der Regel nicht aus, um eine unzumutbare Härte zu begründen. Auch eine persönliche Verbundenheit zum Zuhause oder die Sorge um Haustiere ohne weitere, gravierende Umstände gelten nicht als ausreichend.
Wer eine solche Verlängerung beantragt, muss die schwerwiegenden Gründe detailliert darlegen und mit konkreten Beweisen belegen. Dazu gehören beispielsweise Aufzeichnungen über intensive und erfolglose Wohnungssuchen, die trotz aller Anstrengungen keine neue Bleibe ermöglichen. Diese strenge Auslegung schützt das verfassungsrechtlich garantierte Recht des Vermieters auf Rückgabe seines Eigentums und gewährleistet die Rechtssicherheit im Mietverhältnis.
Was müssen Mieter tun und nachweisen, um eine Verlängerung der Räumungsfrist erfolgreich zu beantragen?
Für einen erfolgreichen Antrag auf Verlängerung einer Räumungsfrist müssen Mieter konkrete und nachvollziehbare Bemühungen um Ersatzwohnraum nachweisen. Es reicht nicht aus, nur zu behaupten, keine Wohnung zu finden.
Stellen Sie sich dies wie eine Jobsuche vor: Wer eine neue Anstellung sucht, muss konkrete Nachweise seiner Bewerbungen und Vorstellungsgespräche erbringen, um die Ernsthaftigkeit seiner Bemühungen zu belegen.
Ein Gericht erwartet, dass man ernsthaft und intensiv eine neue Bleibe gesucht hat. Dazu gehören detaillierte Aufzeichnungen über alle unternommenen Schritte. Man muss dem Gericht konkrete Beweise vorlegen, wie etwa Aufzeichnungen über Wohnungsbesichtigungen und Kopien von Absagen. Ebenso wichtig ist es, die genauen Gründe darzulegen, warum die Suche nach einer neuen Wohnung trotz aller Bemühungen erfolglos blieb.
Nur durch solche umfassenden und nachvollziehbaren Belege kann das Gericht die Notwendigkeit einer Fristverlängerung prüfen und das Vertrauen in die Ernsthaftigkeit der Bemühungen des Mieters schützen. Fehlende oder unzureichende Nachweise können zur Ablehnung des Antrags führen.
Wann kann ein Gericht die Zwangsvollstreckung aus einem Räumungsurteil vorübergehend einstellen?
Ein Gericht kann die Zwangsvollstreckung aus einem Räumungsurteil nur in absoluten Ausnahmefällen vorübergehend einstellen. Dies geschieht, wenn die Zwangsvollstreckung für die betroffene Person eine unzumutbare Härte darstellt, die über die bloße Obdachlosigkeit hinausgeht, wie zum Beispiel eine ernsthafte Gefährdung von Leben oder Gesundheit.
Man kann es sich wie bei einer Notbremse vorstellen: Sie wird nur gezogen, wenn eine extreme Gefahr besteht, nicht bei alltäglichen Schwierigkeiten.
Für einen allgemeinen Schutz vor der Zwangsvollstreckung ist in der Regel das sogenannte Vollstreckungsgericht zuständig. Ein Berufungsgericht kann die Zwangsvollstreckung aus seinem eigenen Urteil nur einstweilen einstellen, wenn die eingelegte Berufung eine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat. Die Gerichte lehnen solche Anträge in der Regel ab, wenn bloß schwierige Umstände wie das Fehlen einer Ersatzwohnung oder die Aussicht auf ein Obdachlosenheim vorliegen, da dies nicht als ausreichend schwerwiegende Härte angesehen wird. Zudem muss das Gericht immer das Recht des Vermieters berücksichtigen, sein Eigentum zurückzuerhalten.
Diese strengen Vorgaben stellen sicher, dass die Rechte beider Parteien – das Eigentumsrecht des Vermieters und die Interessen der räumungspflichtigen Person – sorgfältig abgewogen werden.
Wer ist für die Unterbringung von Personen zuständig, die nach einer Räumung obdachlos werden könnten?
Die Verantwortung für die Unterbringung von Personen, die nach einer Räumung obdachlos werden könnten, liegt in Deutschland bei den Städten und Gemeinden. Genauer gesagt, ist dies eine Aufgabe der jeweiligen Ordnungs- oder Sozialämter.
Man kann es sich vorstellen wie bei einem Spiel, in dem ein Spieler des Feldes verwiesen wird: Es ist nicht die Aufgabe des Gegners, eine neue Mannschaft oder Unterkunft für ihn zu finden, sondern die der zuständigen übergeordneten Instanz oder des Spielers selbst, sich um eine Lösung zu kümmern.
Gerichte stellen klar, dass das Recht eines Vermieters auf Rückgabe seines Eigentums nach einer wirksamen Kündigung in der Regel Vorrang hat. Die Aufgabe der Obdachlosenfürsorge kann dem Vermieter nicht aufgebürdet werden. Dies bedeutet, dass ein Vermieter nicht verpflichtet ist, einem Mieter eine Ersatzwohnung anzubieten oder ihn vor drohender Obdachlosigkeit zu schützen.
Das Fehlen einer neuen Wohnung oder die mögliche Unterbringung in einem Obdachlosenheim allein gelten nicht als so schwerwiegende Härte, dass das Eigentumsrecht des Vermieters dadurch eingeschränkt würde oder eine Räumung dauerhaft verhindert wird.
Diese Regelung stellt sicher, dass die Verantwortung für die soziale Unterbringung bei den dafür vorgesehenen öffentlichen Stellen liegt und private Eigentumsrechte gewahrt bleiben.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Anerkenntnis
Ein Anerkenntnis im juristischen Sinne ist die Erklärung einer Partei vor Gericht, dass sie den Anspruch des Gegners als berechtigt ansieht. Durch ein Anerkenntnis wird der Prozess in diesem Punkt oft schnell beendet, da das Gericht dann ein sogenanntes Anerkenntnisurteil erlassen kann, ohne eine langwierige Beweisaufnahme durchzuführen. Es dient der Prozessökonomie, also der effizienten Abwicklung des Verfahrens.
Beispiel: Im vorliegenden Fall beendete das Anerkenntnis des Vaters den Mietvertrag, da er den Räumungsanspruch des Vermieters vor Gericht als wirksam anerkannte. Dies führte zu einem rechtskräftigen Urteil, das ihn zur Räumung verpflichtete, und hatte weitreichende Folgen für die Tochter, deren Wohnrecht sich von diesem Mietvertrag ableitete.
Eigenbedarf
Eigenbedarf liegt vor, wenn ein Vermieter eine vermietete Wohnung für sich selbst, Familienangehörige oder Angehörige seines Haushalts benötigt. Dieses Recht ermöglicht es Eigentümern, ihr Eigentum zu nutzen, ist aber an strenge Voraussetzungen gebunden, um Mieter vor willkürlichen Kündigungen zu schützen. Der Vermieter muss ein ernsthaftes und nachvollziehbares Interesse an der Nutzung darlegen.
Beispiel: Der Vermieter kündigte der Familie das Haus wegen Eigenbedarfs, da er das Haus für seine eigene Tochter nutzen wollte. Auch wenn die Tochter des Mieters die Echtheit des Eigenbedarfs anzweifelte, spielte dies im späteren Verlauf des Falles keine Rolle mehr, da der Vater den Räumungsanspruch bereits anerkannt hatte.
Rechtskraft
Die Rechtskraft eines Urteils bedeutet, dass eine gerichtliche Entscheidung endgültig und verbindlich ist und nicht mehr mit regulären Rechtsmitteln (wie Berufung oder Revision) angefochten werden kann. Durch die Rechtskraft wird Rechtssicherheit geschaffen. Sie verhindert, dass derselbe Streit immer wieder neu vor Gericht gebracht werden kann und sorgt dafür, dass die getroffene Entscheidung umgesetzt werden muss.
Beispiel: Nachdem der Vater den Räumungsanspruch des Vermieters gerichtlich anerkannt hatte, führte dies zu einem rechtskräftigen Urteil. Dieses Urteil, das die Räumung des Hauses anordnete, war damit unumstößlich und bildete die Grundlage für die weiteren Schritte gegen die Tochter, da es nicht mehr angefochten werden konnte.
Räumungsfrist
Eine Räumungsfrist ist ein vom Gericht gewährter Zeitaufschub, der dem Mieter nach einer Räumungsklage zusätzlich zur Verfügung steht, um eine Ersatzwohnung zu finden und den Umzug zu organisieren. Sie soll dem Mieter in einer Notlage eine faire Chance geben, Obdachlosigkeit zu vermeiden, ohne das Eigentumsrecht des Vermieters übermäßig einzuschränken. Die Frist wird nur unter bestimmten Bedingungen gewährt und ist keine Selbstverständlichkeit.
Beispiel: Das Amtsgericht gewährte der Bewohnerin eine Räumungsfrist bis Ende März 2025. Die Bewohnerin beantragte später erfolglos eine Verlängerung dieser Frist mit der Begründung einer unzumutbaren Härte, konnte aber die dafür nötigen intensiven Suchbemühungen nicht nachweisen.
unzumutbare Härte
Eine unzumutbare Härte ist eine extreme Notlage, die über normale Schwierigkeiten hinausgeht und so gravierend ist, dass eine sofortige oder fristgemäße Durchführung einer Maßnahme (wie einer Räumung) für die betroffene Person nicht zumutbar wäre. Dieses Prinzip soll in absoluten Ausnahmefällen sozialen Schutz bieten, muss jedoch streng ausgelegt werden, um Missbrauch zu verhindern und die Rechte anderer (z.B. des Vermieters) zu wahren. Eine bloße Unannehmlichkeit reicht nicht aus.
Beispiel: Die Bewohnerin berief sich auf eine unzumutbare Härte, um eine längere Räumungsfrist oder einen Schutz vor der Zwangsvollstreckung zu erzwingen. Sie führte an, keine Ersatzwohnung zu finden und um ihre Haustiere zu fürchten. Das Gericht erkannte diese Gründe jedoch nicht als ausreichend schwerwiegend an, um eine Härte im juristischen Sinne zu begründen.
Vollstreckungsschutz
Vollstreckungsschutz ist ein gerichtlicher Antrag, der darauf abzielt, die Durchführung einer Zwangsvollstreckung (z.B. einer Räumung) vorübergehend oder dauerhaft zu verhindern oder einzustellen. Dieser Schutz wird in der Regel gewährt, wenn die Vollstreckung für den Schuldner eine unzumutbare Härte darstellen würde, die über das übliche Maß hinausgeht. Er soll extremen Notlagen begegnen, muss aber das Recht des Gläubigers auf Durchsetzung seines Anspruchs berücksichtigen.
Beispiel: Die Bewohnerin beantragte Vollstreckungsschutz und die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus dem Räumungsurteil. Das Landgericht lehnte dies ab, da das zuständige Gericht in der Regel das Vollstreckungsgericht ist und die geltend gemachten Gründe keine unzumutbare Härte im Sinne der Rechtsprechung darstellten.
Zwangsvollstreckung
Zwangsvollstreckung ist das gerichtliche Verfahren, mit dem staatliche Hilfe in Anspruch genommen wird, um einen Anspruch (z.B. auf Räumung einer Wohnung oder Zahlung von Geld) gegen den Willen des Schuldners durchzusetzen. Sie dient dazu, die im Urteil festgestellten Rechte und Pflichten auch tatsächlich durchzusetzen, wenn der Schuldner dies nicht freiwillig tut. Sie ist das „letzte Mittel“ des Staates, um die Einhaltung von Gerichtsurteilen sicherzustellen.
Beispiel: Nachdem die Räumungsurteile gegen Vater und Tochter ergangen waren und die Tochter das Haus nicht freiwillig verlassen wollte, drohte die Zwangsvollstreckung des Räumungsanspruchs. Die Bewohnerin versuchte erfolglos, diese durch Anträge auf Verlängerung der Räumungsfrist und Vollstreckungsschutz zu verhindern.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- Rolle als Nicht-Mieterin (Allgemeines Vertragsrecht und Mietrecht)
Die rechtliche Stellung einer Person im Mietverhältnis entscheidet darüber, welche Rechte und Pflichten sie gegenüber dem Vermieter hat.→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Tochter war keine eigene Mieterin, sondern durfte das Haus nur als Angehörige des Vaters bewohnen; damit hatte sie keine eigenen Rechte, die über die des Vaters hinausgingen oder unabhängig von dessen Mietvertrag bestanden.
- Wirkung eines Anerkenntnisurteils (§ 307 Zivilprozessordnung – ZPO)
Ein Anerkenntnisurteil wird erlassen, wenn eine Partei den gegen sie erhobenen Anspruch vor Gericht ausdrücklich als richtig anerkennt.→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Da der Vater des Mieters den Räumungsanspruch des Vermieters vor Gericht anerkannt hatte, wurde die Räumungspflicht rechtskräftig festgestellt, und die nachfolgenden Einwände der Tochter gegen die Kündigung wegen Eigenbedarfs wurden hinfällig.
- Härteeinwand und Räumungsfrist (§ 721 Zivilprozessordnung – ZPO)
Ein Gericht kann bei einer Räumung auf Antrag des Mieters eine längere Frist zum Auszug gewähren, wenn die sofortige Räumung eine besondere Härte darstellen würde.→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht hatte der Tochter bereits eine Räumungsfrist gewährt, lehnte eine Verlängerung aber ab, weil sie die erforderlichen, nachweisbaren Bemühungen um eine neue Wohnung nicht darlegen konnte und keine unverhältnismäßige Härte vorlag, die die Eigentumsrechte des Vermieters überwiegen würde.
- Vollstreckungsschutz und Eigentumsgarantie (§ 765a Zivilprozessordnung – ZPO und Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz – GG)
Die Vollstreckung einer Gerichtsentscheidung kann nur in extremen Ausnahmefällen gestoppt oder verhindert werden, um die Rechte der Schuldner zu schützen, wobei das Eigentumsrecht des Gläubigers eine hohe verfassungsrechtliche Bedeutung hat.→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Tochter wollte die Zwangsvollstreckung verhindern, doch das Gericht lehnte dies ab, da eine solche Maßnahme nur bei einer ernsthaften Gefährdung von Leben oder Gesundheit zulässig ist und das Recht des Vermieters auf sein Eigentum stark geschützt ist.
Das vorliegende Urteil
LG Lüneburg – Az.: 6 S 8/25 – Beschluss vom 25.03.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.





