Ein Mieter versuchte, die wirksame Eigenbedarfskündigung trotz Härtefall abzuwenden, indem er sich auf seine schwere Krankheit und einen juristischen Formfehler berief. Letztlich galt die Berufung auf den Geister-Mieter als treuwidrig und die Härtefall-Argumentation scheiterte an unrealistischen Suchkriterien.
Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Die Urteilslogik
- Benötigen Sie Hilfe?
- Experten Kommentar
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Reicht meine schwere Krankheit aus, um eine Eigenbedarfskündigung als Härtefall abzuwehren?
- Wann kann ich mich bei einem Formfehler der Kündigung nicht auf meine Mieterrechte berufen?
- Welche Nachweise muss ich erbringen, um meine intensive Suche nach Ersatzwohnraum zu belegen?
- Wann gilt der Eigenbedarf meines Vermieters als zu vage oder auf Vorrat gekündigt?
- Wie lange ist die gesetzliche Räumungsfrist, wenn der Härtefall abgelehnt wurde?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 30 S 59/25 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Landgericht Darmstadt
- Datum: 29.04.2025
- Aktenzeichen: 30 S 59/25
- Verfahren: Berufung
- Rechtsbereiche: Mietrecht, Zivilrecht
- Das Problem: Neue Eigentümer kündigten das Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs und geplantem Neubau. Die langjährigen Mieter wehrten sich gegen die Kündigung. Sie beriefen sich auf formale Fehler und schwerwiegende gesundheitliche Härtefälle.
- Die Rechtsfrage: Durften die Vermieter wirksam kündigen, obwohl ein ursprünglicher Mieter seit Jahrzehnten ausgezogen ist und die aktuellen Mieter schwere Krankheiten als Härtefall geltend machen?
- Die Antwort: Ja, die Kündigung ist wirksam. Die Kläger konnten ihren Eigenbedarf plausibel beweisen. Das Gericht sah die formalen Einwände der Mieter als rechtsmissbräuchlich an.
- Die Bedeutung: Der Anspruch auf Eigenbedarf überwiegt, wenn die Mieter nicht intensiv genug nach Ersatzwohnraum suchen. Mieter können sich nicht auf rein formale Rechte eines seit langer Zeit ausgezogenen Partners berufen.
Der Fall vor Gericht
Warum zählte der Name eines Mieters nicht, der seit 40 Jahren verschwunden war?
Ein Mietvertrag aus dem Jahr 1981. Zwei Namen stehen darauf: eine Frau und ihr damaliger Ehemann. Fast vierzig Jahre später ist die Ehe längst geschieden, der Mann lebt seit den 1980er-Jahren in Serbien, der Kontakt ist abgerissen. Die Frau wohnt weiter in dem Haus, inzwischen mit ihrem neuen Ehemann. Als die neuen Eigentümer des Hauses Eigenbedarf anmelden und kündigen, zielt die Verteidigung der Mieter auf ein formales Detail: Die Kündigung ging nur an die Frau, nicht aber an den „Geistermieter“ von damals. Ein juristischer Kniff, der die gesamte Räumungsklage zu Fall bringen sollte. Das Landgericht Darmstadt stand vor der Frage: Kann ein seit Jahrzehnten abwesender Vertragspartner eine Kündigung blockieren, die ihn faktisch gar nicht mehr betrifft?
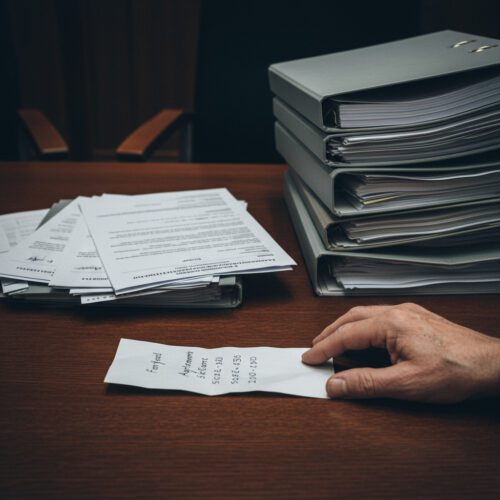
Das Gericht entschied: Die Mieterin kann sich nicht auf diesen Formfehler berufen. Ihre Argumentation wurde als treuwidrig eingestuft. Grundsätzlich muss eine Kündigung zwar allen Mietern zugehen, die im Vertrag stehen. Eine Ausnahme gilt aber, wenn die Berufung auf dieses Recht missbräuchlich ist. Die Richter sahen hier einen solchen Missbrauch. Die Frau hatte in der Verhandlung selbst zugegeben, gar nicht mehr mit ihrem Ex-Mann zusammenleben zu wollen. Die Behauptung, sie brauche ihn noch als Mithafter für eventuelle Schulden, erschien dem Gericht nach 40 Jahren ohne Kontakt und angesichts der neuen Lebensumstände als reine Schutzbehauptung. Der Mann hatte kein erkennbares Interesse mehr an der Wohnung. Die formale Rechtsposition zu nutzen, um die Kündigung zu kippen, war ein Schachzug, den das Gericht nicht mitging. Die Kündigung war wirksam an die verbliebene Mieterin gerichtet.
War die Kündigung unzulässig, weil die Vermieter nur vage Pläne hatten?
Die Mieter brachten ein weiteres starkes Argument vor: Die neuen Eigentümer hätten auf Vorrat gekündigt. Ihr Eigenbedarf sei nicht konkret genug. Sie begründeten die Kündigung unter anderem mit dem Wunsch, eine Familie zu gründen und Platz für ein Homeoffice zu schaffen. Eine geplante Familiengründung – so die Mieter – sei ein unbestimmtes Zukunftsevent. Zudem lag zum Zeitpunkt der Kündigung keine aktuelle Baugenehmigung für den geplanten Abriss und Neubau vor.
Das Landgericht Darmstadt pulverisierte diesen Einwand. Es stellte klar, dass der Eigenbedarf nach § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB auf mehreren Säulen ruhte. Selbst wenn man die Familiengründung als weniger konkretes Motiv ansehen würde, blieb der nachgewiesene Platzbedarf für die Heimarbeit als solider Kündigungsgrund bestehen. Das Gericht verwies auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts: Der Wunsch, eine Familie zu gründen, ist ein legitimer und ernstzunehmender Nutzungswunsch. Er ist nicht per se eine vage Spekulation.
Auch das Fehlen der Baugenehmigung änderte nichts. Die Wirksamkeit einer Eigenbedarfskündigung verlangt nicht, dass alle Genehmigungen schon auf dem Tisch liegen. Entscheidend ist, dass die Pläne ein Stadium erreicht haben, in dem ihre Umsetzbarkeit realistisch erscheint. Die neuen Eigentümer konnten sich auf eine bereits 2016 erteilte Genehmigung der Voreigentümer stützen. Ein Zeuge bestätigte, dass die aktuellen Pläne nur geringfügig davon abwichen und genehmigungsfähig seien. Es ist Vermietern nicht zuzumuten, teure und zeitlich befristete Genehmigungen einzuholen, bevor der Ausgang eines Räumungsprozesses feststeht. Die Kündigung war somit ausreichend begründet.
Was zählt als unzumutbare Härte und warum reichte eine Krebserkrankung nicht aus?
Das letzte und gewichtigste Argument der Mieter war der Verweis auf eine unzumutbare Härte nach § 574 BGB. Der Ehemann war kurz vor der Verhandlung an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt, eine Operation stand bevor, gefolgt von einer monatelangen Chemotherapie. Die Mieterin selbst litt unter mehreren chronischen Krankheiten. Sie argumentierten, ein Umzug sei unter diesen Umständen unmöglich.
Das Gericht wies auch diesen Punkt zurück und machte die hohen Hürden für einen Härtefall deutlich. Es anerkannte die schwere Erkrankung, sah darin aber keinen Grund, der einen Umzug dauerhaft unzumutbar machte. Die vorgelegten Atteste beschrieben die Krankheiten, belegten aber nicht konkret, warum ein Wohnungswechsel eine dauerhafte und unzumutbare Gesundheitsgefahr darstellen würde. Das Gericht verwies darauf, dass die Familie von Angehörigen unterstützt wird und die Mieter den Umzug nicht allein stemmen müssten. Ein Umzug in eine barrierefreie Wohnung – ein Kriterium, das die Mieter bei ihrer eigenen Suche anführten – wäre angesichts ihrer Gesundheitsprobleme ohnehin sinnvoll, da die aktuelle Wohnung nicht barrierefrei war.
Der entscheidende Punkt war die mangelhafte Suche nach einer Ersatzwohnung. Wer sich auf einen Härtefall beruft, muss nachweisen, dass er sich intensiv und ernsthaft um eine neue Bleibe bemüht hat. Die Mieter legten eine Liste mit 23 Wohnungskontakten in 35 Monaten vor. Das war dem Gericht zu wenig. Es fehlten Belege wie E-Mail-Verkehr, Absagen von Vermietern oder Anfragen bei Maklern. Die Suchkriterien – eine barrierefreie 4-Zimmer-Wohnung für maximal 1.000 Euro Warmmiete im teuren Rhein-Main-Gebiet – werteten die Richter als unrealistisch.
In der Gesamtabwägung überwog das Interesse der neuen Eigentümer, ihr Eigentum selbst zu nutzen. Die Mieter wussten seit Jahren, dass ein Auszug drohen könnte, da schon die Voreigentümer entsprechende Pläne hatten. Das Gericht gewährte den Mietern aber aus Billigkeitsgründen eine Räumungsfrist von vier Monaten bis zum 29. August 2025. Diese Frist nach § 721 ZPO berücksichtigte die gerade erfolgte Operation des Mannes und die anstehende Chemotherapie. Sie gab den Mietern Zeit, ihre Suche nach einer neuen Wohnung – nun mit realistischeren Kriterien – fortzusetzen.
Die Urteilslogik
Die Gerichte bewerten die Rechtsverteidigung von Mietern streng und legen fest, dass formale Rechte dort enden, wo der Rechtsmissbrauch beginnt.
- [Treuepflicht Übersteigt Formalismus]: Ein Mieter kann sich nicht treuwidrig auf das Fehlen der Kündigung für einen formellen Mitvertragspartner berufen, der seit Jahrzehnten keinen tatsächlichen Bezug mehr zur Wohnung hat.
- [Krankheit Erfordert Dauerhafte Unzumutbarkeit]: Selbst schwerwiegende Erkrankungen begründen nur dann eine unzumutbare Härte gegen eine Kündigung, wenn sie einen Umzug dauerhaft und konkret gesundheitsgefährdend machen.
- [Nachweispflicht der Ersatzsuche ist Zwingend]: Wer sich erfolgreich auf einen Härtefall berufen will, muss eine intensive, dokumentierte Suche nach Ersatzwohnraum mit realistischen Kriterien belegen.
Das Mietrecht verlangt von den Parteien stets Fairness und Transparenz, während es Eigentümern ermöglicht, ihre legitimen Lebensplanungen umzusetzen.
Benötigen Sie Hilfe?
Überwiegt der Eigenbedarf auch in Ihrem Fall trotz schwerwiegender Härtefälle? Kontaktieren Sie uns für eine erste rechtliche Einschätzung Ihrer Kündigungssituation.
Experten Kommentar
Viele Mieter verlassen sich darauf, dass eine schwere Erkrankung die Eigenbedarfskündigung automatisch zu Fall bringt. Dieses Urteil zieht eine klare rote Linie: Der Härtefall nach § 574 BGB ist keine Dauerfreikarte, selbst wenn die Diagnose Krebs lautet. Entscheidend war die mangelhafte Suche nach Ersatzwohnraum und das Festhalten an unrealistischen Suchkriterien über Jahre. Wer seine Pflicht zur aktiven Wohnungssuche vernachlässigt, kann sich später nicht auf unzumutbare Härte berufen – die Konsequenz ist die Räumung, auch wenn das Gericht eine lange Frist zur Schonung gewährt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Reicht meine schwere Krankheit aus, um eine Eigenbedarfskündigung als Härtefall abzuwehren?
Eine schwere Krankheit allein genügt nicht, um eine Eigenbedarfskündigung dauerhaft abzuwehren. Zwar erkennt § 574 BGB gesundheitliche Gefahren als Härtefall an, Gerichte stellen jedoch hohe Anforderungen an den Nachweis der Unzumutbarkeit. Ausschlaggebend ist oft nicht die Diagnose, sondern die fehlende Dokumentation Ihrer intensiven Suchbemühungen nach einer Ersatzwohnung.
Ihr ärztliches Attest muss konkret belegen, dass ein Umzug eine konkrete und dauerhafte Gesundheitsgefahr darstellt. Vorgelegte Atteste, die lediglich den Krankheitszustand beschreiben, ohne die Gefahr des Wohnungswechsels zu begründen, gelten als unzureichend. Ist die aktuelle Wohnung beispielsweise nicht barrierefrei, werten Richter einen notwendigen Umzug in eine geeignete Bleibe sogar als gesundheitlich förderlich. Die Krankheit muss die Unzumutbarkeit der Umzugsorganisation selbst beweisen, nicht nur die Schwere des Leidens.
Der entscheidende Mangel in vielen Härtefallverfahren liegt in der mangelhaften Nachweisführung der Wohnungssuche. Ein Gericht lehnte den Härtefall trotz Krebserkrankung ab, weil die Mieter nur 23 Wohnungskontakte in 35 Monaten vorweisen konnten. Solche geringen Bemühungen wirken auf Richter wie eine Alibi-Übung, besonders wenn die Suchkriterien als unrealistisch gelten. Wer sich auf eine Härte beruft, muss seine ernsthaften und kontinuierlichen Bemühungen um Ersatzwohnraum belegen.
Bitten Sie Ihren behandelnden Arzt unverzüglich um ein detailliertes Attest, das die akute Gefahr eines Umzugs für die nächsten zwölf Monate explizit beschreibt.
Wann kann ich mich bei einem Formfehler der Kündigung nicht auf meine Mieterrechte berufen?
Eine Kündigung müssen Vermieter grundsätzlich allen im Mietvertrag genannten Personen zustellen. Sie können sich jedoch nicht auf diesen Formfehler berufen, wenn die Geltendmachung des Mangels als treuwidrig gilt. Dies ist der Fall, wenn die Berufung auf den Formfehler einen offensichtlichen Rechtsmissbrauch darstellt (§ 242 BGB). Das Gericht prüft, ob der nicht gekündigte Mitmieter faktisch seit Jahrzehnten abwesend ist und kein erkennbares Interesse mehr an der Wohnung hat.
Das deutsche Recht schützt Mieter zwar vor formlosen Kündigungen, erwartet aber von allen Parteien die Einhaltung von Treu und Glauben. Wenn nur noch ein Vertragspartner die Wohnung nutzt und der andere seit Jahrzehnten verschwunden ist, wertet das Gericht das Festhalten am Formzwang als unlauter. Die fehlende Zustellung an diesen sogenannten Geistermieter wird dann nicht als maßgeblicher Mangel angesehen. Die Argumentation, der seit Langem abwesende Mitmieter sei noch relevant, wird oft als reine Schutzbehauptung eingestuft.
Konkret: Das Landgericht Darmstadt entschied in einem Fall, dass eine Mieterin sich nicht auf den Fehler berufen durfte. Ihr Ex-Ehemann stand zwar im Vertrag von 1981, lebte aber seit den 1980er-Jahren im Ausland ohne jeglichen Kontakt zur Wohnung. Da der Mitmieter kein erkennbares Interesse mehr an der Wohnung hatte, stellte die Frau ihre Argumentation in einem missbräuchlichen Kontext dar. Das Gericht erkannte, dass der Formfehler nur vorgeschoben wurde, um die Kündigung abzuwehren.
Überprüfen Sie sofort alle formalen Kündigungsschreiben auf die Adressatenliste und ermitteln Sie, ob ein fehlender Mitmieter in den letzten fünf Jahren nachweislich Kontakt zur Wohnung hatte oder Haftung übernommen hat.
Welche Nachweise muss ich erbringen, um meine intensive Suche nach Ersatzwohnraum zu belegen?
Gerichte legen hohe Maßstäbe an den Nachweis der Ersatzwohnungssuche an, besonders wenn Sie sich auf einen Härtefall berufen. Eine einfache Liste von lediglich kontaktierten Adressen reicht nicht aus. Sie müssen detaillierte Belege für alle gescheiterten Versuche vorlegen, um die ernsthafte und kontinuierliche Suche zu beweisen. Juristisch entscheidend ist die lückenlose Dokumentation, die zeigt, dass Vermieter Ihre Anfragen tatsächlich abgelehnt haben.
Der Härtefallschutz greift nur, wenn Mieter alles Zumutbare getan haben, um die drohende Obdachlosigkeit abzuwenden. Das Gericht prüft nicht nur die Anzahl der Anfragen, sondern auch deren Qualität und die zeitliche Frequenz. Beispielsweise stuften Richter 23 Kontakte in 35 Monaten als völlig unzureichend ein. Ihre Suchbemühungen müssen aktiv, nachweisbar und realistisch sein, damit sie als intensiver Versuch gelten.
Konkret benötigen Sie Nachweise über die Reaktion der Vermieter auf Ihre Kontaktversuche. Sammeln Sie den gesamten E-Mail-Verkehr, Screenshots von Anzeigen, auf die Sie geantwortet haben, sowie alle schriftlichen Absagen von Maklern und Eigentümern. Achten Sie gleichzeitig darauf, dass Ihre Suchkriterien zur regionalen Marktlage passen. Wenn Sie beispielsweise eine barrierefreie Vierzimmerwohnung für maximal 1.000 Euro Warmmiete im teuren Ballungsraum suchen, gilt dies als unrealistisch.
Erstellen Sie umgehend ein digitales Logbuch, das jeden Kontakt mit Datum, Adresse und einem verlinkten Dokumentationsbeleg der Ablehnung strukturiert festhält.
Wann gilt der Eigenbedarf meines Vermieters als zu vage oder auf Vorrat gekündigt?
Die Befürchtung, Vermieter würden auf Vorrat kündigen oder nur spekulieren, ist nachvollziehbar. Ein Eigenbedarf ist jedoch nicht automatisch vage, wenn die Pläne noch nicht bis ins letzte Detail ausgearbeitet sind. Entscheidend für die Wirksamkeit der Kündigung ist die Ernsthaftigkeit des Nutzungswunsches, der klar und nachvollziehbar dargelegt werden muss.
Der Vermieter benötigt einen legitimen Nutzungswunsch, um nach § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB kündigen zu dürfen. Solide Gründe sind beispielsweise der Bedarf an mehr Platz für die eigene Heimarbeit oder der Wunsch nach Gründung einer Familie. Der Wunsch nach Familiengründung gilt laut Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als ernstzunehmendes Motiv und wird nicht als bloße Spekulation eingestuft. Solange diese Motive ernsthaft verfolgt werden, ist der Eigenbedarf konkret genug.
Viele Mieter hoffen, die Kündigung wegen fehlender Dokumente zu Fall zu bringen, etwa weil eine aktuelle Baugenehmigung für geplante Umbauten fehlt. Dies ist juristisch irrelevant. Vermieter müssen teure und zeitlich befristete Genehmigungen nicht einholen, solange der Ausgang eines Räumungsprozesses noch unklar ist. Die Pläne des Vermieters müssen lediglich ein realistisches Umsetzungsstadium erreicht haben, damit die Eigenbedarfskündigung wirksam bleibt.
Verlangen Sie vom Vermieter die genaue schriftliche Begründung, warum die geplante Nutzung nicht in dessen aktueller Wohnung realisierbar ist, um die Ernsthaftigkeit seiner Pläne detailliert zu prüfen.
Wie lange ist die gesetzliche Räumungsfrist, wenn der Härtefall abgelehnt wurde?
Wenn Ihr eigentlicher Härtefall nach § 574 BGB abgelehnt wird, endet die Möglichkeit, die Kündigung aufzuheben. Es existiert keine automatische gesetzliche Verlängerung der Mietzeit. Dennoch kann das Gericht aus Billigkeitsgründen eine separate Räumungsfrist gewähren, die der Organisation des Umzugs dient. Diese Frist richtet sich nach § 721 der Zivilprozessordnung (ZPO) und wird stets individuell bemessen.
Der zentrale Unterschied liegt in der Zielsetzung der Paragraphen. Der Härtefall nach § 574 BGB zielt darauf ab, die Kündigung als unwirksam zu erklären, um das Mietverhältnis fortzusetzen. Die Frist nach § 721 ZPO hingegen akzeptiert die Wirksamkeit der Kündigung, gewährt Ihnen aber zusätzlich Zeit, Obdachlosigkeit oder unzumutbare logistische Notlagen zu vermeiden. Diese Billigkeitslösung greift oft, wenn akute, zeitlich fixierte Ereignisse wie Operationstermine oder Chemotherapiezyklen den sofortigen Auszug unmöglich machen.
Ein Beispiel: Die schwere Erkrankung eines Mieters wurde zwar als gravierend anerkannt, die fehlende intensive Suche nach Ersatzwohnraum führte aber zur Ablehnung des Härtefalls. Trotz dieser Niederlage berücksichtigte das Gericht die bevorstehende Operation des Mannes. Es gewährte daraufhin vier Monate Zeit bis zum Räumungstermin, wie es im Artikel beschrieben ist. Diese Frist ist einmalig und dient nur dazu, die Suche mit realistischeren Kriterien fortzusetzen und den Übergang in die neue Wohnsituation zu organisieren.
Beauftragen Sie Ihren Anwalt, bei einer Berufung präzise medizinische Unterlagen über zeitlich fixierte Behandlungszyklen vorzulegen, um die maximal mögliche Frist nach § 721 ZPO zu begründen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Eigenbedarfskündigung
Eine Eigenbedarfskündigung ist die Beendigung eines Mietverhältnisses durch den Vermieter, weil er oder seine nahen Angehörigen die Wohnung tatsächlich selbst nutzen möchten. Dieses Recht ist grundgesetzlich durch den Schutz des Eigentums (Art. 14 GG) verankert und erlaubt es dem Eigentümer, über sein Vermögen zu verfügen. Das Gesetz verlangt aber einen ernsthaften und konkreten Nutzungswunsch, um Spekulationen oder Kündigungen „auf Vorrat“ zu verhindern.
Beispiel: Im vorliegenden Fall begründeten die neuen Eigentümer die Eigenbedarfskündigung mit dem Platzbedarf für die geplante Heimarbeit und dem Wunsch nach Familiengründung, was das Gericht als ausreichend konkret einstufte.
Räumungsfrist (§ 721 ZPO)
Gerichte können eine Räumungsfrist nach der Zivilprozessordnung gewähren, wenn eine wirksame Kündigung vorliegt, der Mieter aber aus Billigkeitsgründen nicht sofort ausziehen kann. Dieses Instrument dient nicht dazu, die Kündigung aufzuheben, sondern dem Mieter eine notwendige zeitliche Gnadenfrist zur Organisation des Umzugs zu verschaffen, oft unter Berücksichtigung akuter medizinischer Notlagen oder der Wohnungssuche.
Beispiel: Obwohl der Härtefall wegen mangelhafter Suchbemühungen abgewiesen wurde, erhielt der kranke Mieter aufgrund seiner bevorstehenden Operation und Chemotherapie eine Räumungsfrist von vier Monaten.
Treu und Glauben (§ 242 BGB)
Treu und Glauben ist ein fundamentaler Rechtsgrundsatz, der besagt, dass jeder in einer Wechselbeziehung stehende Mensch sich loyal und redlich verhalten muss. Dieser Paragraph – oft als „Königsnorm“ bezeichnet – verhindert, dass jemand seine formalen Rechte auf unfaire, missbräuchliche oder widersprüchliche Weise nutzt, wenn dies dem eigentlichen Gerechtigkeitsgedanken widerspricht.
Beispiel: Der Grundsatz von Treu und Glauben führte im Fall des Geistermieters dazu, dass die Mieterin den formalen Kündigungsfehler nicht nutzen durfte, da ihr Verhalten ansonsten treuwidrig gewesen wäre.
Treuwidrigkeit
Juristen nennen es Treuwidrigkeit, wenn eine Partei ein formales Recht geltend macht, obwohl dieses Verhalten aufgrund der Umstände unfair oder widersprüchlich erscheint. Die Einordnung als treuwidrig dient dem Schutz des Rechtsverkehrs und stellt sicher, dass Rechtsansprüche im Einklang mit den moralischen und ethischen Vorstellungen einer Gesellschaft stehen, insbesondere wenn sie nur vorgeschoben werden.
Beispiel: Das Landgericht Darmstadt stufte die Berufung der Mieterin auf den fehlenden Zugang der Kündigung beim seit 40 Jahren abwesenden Ex-Mann als treuwidrig ein, weil sie nur vorgeschoben wurde, um die Räumung zu verhindern.
Unzumutbare Härte (§ 574 BGB)
Eine Unzumutbare Härte liegt im Mietrecht vor, wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter oder seine Familie eine derart große Last darstellen würde, dass sie selbst das berechtigte Interesse des Vermieters übersteigt. Das Gesetz (§ 574 BGB) soll in Ausnahmefällen den Mieter vor Obdachlosigkeit oder schwerwiegenden gesundheitlichen Nachteilen schützen und ermöglicht die Fortsetzung des Mietverhältnisses, oft bei schwerer Krankheit.
Beispiel: Obwohl die Krebserkrankung des Ehemanns schwerwiegend war, reichte sie für die Annahme einer unzumutbaren Härte nicht aus, da die Mieter keine intensiven Suchbemühungen nach einer barrierefreien Ersatzwohnung nachweisen konnten.
Das vorliegende Urteil
LG Darmstadt – Az.: 30 S 59/25 – Urteil vom 29.04.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.






