Eine Vermieterin versuchte über ein Jahr mit mehreren Kündigungen ihre Mieter nach fast drei Jahrzehnten aus dem Zweifamilienhaus in Gießen zu bekommen. Am Ende scheiterten alle Versuche, denn der Keller entpuppte sich als unerwartete dritte Wohnung.
Übersicht
- Das Urteil in 30 Sekunden
- Die Fakten im Blick
- Der Fall vor Gericht
- Warum landete ein Mietstreit über ein Zweifamilienhaus vor dem Amtsgericht Gießen?
- Wieso war die Kündigung wegen Mietrückständen trotz offener Beträge unwirksam?
- Warum scheiterte auch die Kündigung wegen angeblicher Bedrohungen?
- Auf welcher Grundlage entschied das Gericht, ob es sich um ein Zwei- oder Dreifamilienhaus handelt?
- Die Urteilslogik
- Benötigen Sie Hilfe?
- Das Urteil in der Praxis
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 46 C 55/24 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Urteil in 30 Sekunden
- Das Problem: Eine Vermieterin wollte das Mietverhältnis mit langjährigen Mietern beenden. Sie sprach mehrere Kündigungen aus, doch die Mieter weigerten sich auszuziehen.
- Die Rechtsfrage: Konnten die Kündigungen das Mietverhältnis wirksam beenden?
- Die Antwort: Nein. Das Gericht erklärte alle Kündigungen für unwirksam. Weder angebliche Schulden, verzögerte Vorwürfe noch die Hausgröße waren Kündigungsgründe.
- Die Bedeutung: Das Gericht schützt Mieter vor unklarer Kommunikation und verzögerten Vorwürfen. Eine erleichterte Kündigung setzt zudem eine genaue Prüfung der Wohnungsanzahl voraus.
Die Fakten im Blick
- Gericht: Amtsgericht Gießen
- Datum: 17.01.2025
- Aktenzeichen: 46 C 55/24
- Verfahren: Räumungsklage
- Rechtsbereiche: Mietrecht, Zivilprozessrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Eine Vermieterin, die im Erdgeschoss wohnt. Sie wollte die im Obergeschoss wohnenden Mieter zur Räumung und Herausgabe der Wohnung zwingen.
- Beklagte: Mieter, die im 1. Stock des Hauses leben. Sie wehrten sich gegen die Kündigungen und forderten die Abweisung der Klage.
Worum ging es genau?
- Sachverhalt: Eine Vermieterin wollte ihre Mieter aus der Wohnung im Obergeschoss eines Zweifamilienhauses räumen lassen. Sie hatte das Mietverhältnis mehrfach gekündigt.
Welche Rechtsfrage war entscheidend?
- Kernfrage: Waren die Kündigungen der Vermieterin wirksam, die sie wegen angeblichen Mietrückständen, Drohungen und der Anzahl der Wohnungen im Haus aussprach?
Entscheidung des Gerichts:
- Urteil im Ergebnis: Die Klage wird abgewiesen.
- Zentrale Begründung: Das Gericht befand, dass die von der Vermieterin ausgesprochenen Kündigungen aus verschiedenen Gründen unwirksam waren.
- Konsequenzen für die Parteien: Die Mieter dürfen in der Wohnung bleiben, und die Vermieterin muss die gesamten Prozesskosten tragen.
Der Fall vor Gericht
Warum landete ein Mietstreit über ein Zweifamilienhaus vor dem Amtsgericht Gießen?
Ein Mietverhältnis, das fast drei Jahrzehnte Bestand hatte, fand sich plötzlich im Zentrum eines erbitterten Rechtsstreits wieder. Eine Vermieterin, die selbst im Erdgeschoss eines Hauses in der Nähe von Gießen wohnt, wollte die Wohnung im ersten Stock freibekommen. Dort lebten ihre Mieter seit 1996. Um ihr Ziel zu erreichen, griff die Eigentümerin zu mehreren Kündigungen, die sie auf ganz unterschiedliche Gründe stützte. Die Mieter wehrten sich jedoch und weigerten sich auszuziehen. Schließlich reichte die Vermieterin eine Räumungsklage ein, und der Fall landete vor dem Amtsgericht Gießen. Die Richter mussten nun klären, ob auch nur eine der ausgesprochenen Kündigungen das langjährige Mietverhältnis wirksam beenden konnte.
Wieso war die Kündigung wegen Mietrückständen trotz offener Beträge unwirksam?
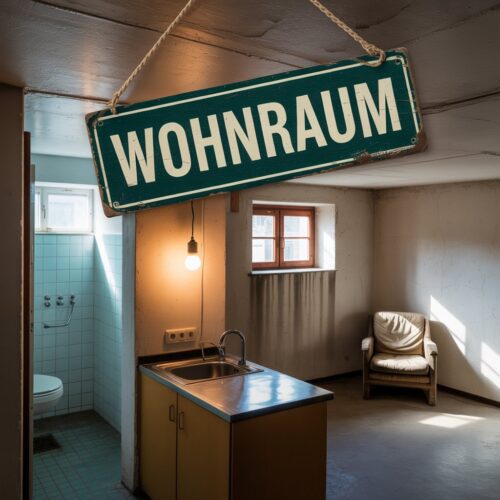
Die erste Kündigung, datiert auf den 31. August 2023, stützte die Vermieterin auf angebliche Mietschulden. Sie rechnete vor, die Mieter seien mit einem Betrag von 1.636,16 € im Verzug. Dieser Rückstand sei entstanden, nachdem sie einer Mieterhöhung zugestimmt hätten. Die Vorgeschichte dazu war kompliziert: Ursprünglich zahlten die Mieter jahrelang unbeanstandet eine Pauschalmiete von 500,00 €. Im Februar 2022 verlangte die Vermieterin dann schriftlich eine Erhöhung auf 600,00 € pro Monat. Die Mieter unterzeichneten das Schreiben und zahlten ab Mai 2022 auch prompt die geforderten 600,00 €.
Die Vermieterin argumentierte nun, diese 600,00 € seien nur die neue Kaltmiete gewesen. Die Mieter hätten zusätzlich die alten Nebenkostenvorauszahlungen von 102,26 € weiterzahlen müssen. Da sie dies 16 Monate lang nicht taten, sei der kündigungsrelevante Rückstand entstanden.
Das Gericht sah das jedoch anders und erklärte die Kündigung für unwirksam. Es berief sich dabei auf einen fundamentalen Grundsatz des deutschen Rechts: den Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB). Dieser besagt vereinfacht, dass sich Vertragspartner fair und anständig verhalten müssen. Ein rein formaler Rechtsanspruch darf nicht missbräuchlich ausgenutzt werden. Genau das war hier nach Ansicht der Richter der Fall. Für die Mieter war nach jahrelanger Zahlung von 500,00 € und der Unterzeichnung eines Erhöhungsverlangens auf 600,00 € klar erkennbar, dass sie nun genau diesen Betrag schuldeten. Wenn die Vermieterin der Meinung war, dass zusätzlich noch Nebenkosten fällig wären, hätte sie die Mieter darauf hinweisen müssen. Man nennt dies im Juristendeutsch eine Abmahnung.
Stattdessen wartete die Vermieterin 16 Monate lang stillschweigend ab, bis sich ein vermeintlicher Rückstand angesammelt hatte, der für eine fristlose Kündigung ausreichte. Dieses Verhalten wertete das Gericht als rechtsmissbräuchlich. Es ist nicht fair, einen Mieter sehenden Auges in einen Kündigungsgrund hineinlaufen zu lassen, der auf einem offenkundigen Missverständnis beruht. Eine einfache Klarstellung hätte das Problem gelöst. Da diese unterblieb, war sowohl die fristlose als auch die hilfsweise ausgesprochene ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs vom Tisch.
Warum scheiterte auch die Kündigung wegen angeblicher Bedrohungen?
Nachdem der erste Versuch gescheitert war, sprach die Vermieterin am 16. Mai 2024 eine weitere Kündigung aus. Diesmal lautete der Vorwurf, die Mieter hätten sie am 20. Oktober 2023 aggressiv bedroht und angedroht, die Wohnung zu verwüsten. Eine solche Störung des Hausfriedens kann grundsätzlich eine fristlose Kündigung rechtfertigen.
Doch auch hier folgte das Gericht der Argumentation der Vermieterin nicht. Die Richter ließen sogar offen, ob es die behaupteten Drohungen tatsächlich gegeben hatte. Der entscheidende Punkt war ein anderer: die Zeit. Zwischen dem angeblichen Vorfall im Oktober 2023 und der Kündigung im Mai 2024 waren mehr als sieben Monate vergangen. Das Gericht zog hier einen Rechtsgedanken aus einem anderen Paragrafen heran (§ 314 Abs. 3 BGB), der besagt, dass ein Recht zur fristlosen Kündigung nur innerhalb einer angemessenen Frist ausgeübt werden kann, nachdem man von dem Kündigungsgrund erfahren hat.
Die Logik dahinter ist einfach: Wenn ein Verhalten so unerträglich ist, dass es die sofortige Beendigung eines Vertrages rechtfertigt, dann muss der Betroffene auch zeitnah handeln. Wer monatelang wartet, zeigt damit, dass die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses offenbar doch nicht so unzumutbar war. Das Recht zur Kündigung ist in einem solchen Fall „verwirkt“, also verloren. Da die Vermieterin keine besonderen Gründe für die lange Verzögerung vorbringen konnte, war auch diese Kündigung unwirksam.
Auf welcher Grundlage entschied das Gericht, ob es sich um ein Zwei- oder Dreifamilienhaus handelt?
Der letzte und juristisch spannendste Pfeil im Köcher der Vermieterin war eine besondere Form der Kündigung: die sogenannte erleichterte Kündigung nach § 573a BGB. Dieses Gesetz erlaubt es einem Vermieter, der mit im selben Gebäude wohnt, seinem Mieter ohne Angabe von Gründen zu kündigen. Es gibt dabei nur eine entscheidende Bedingung: Das Gebäude darf insgesamt nicht mehr als zwei Wohnungen haben.
Die Vermieterin argumentierte, genau das sei hier der Fall. Ihr Haus sei baurechtlich als Zweifamilienhaus genehmigt, mit ihrer Wohnung im Erdgeschoss und der der Mieter im ersten Stock. Die Kellerräume seien eben nur ein Keller. Die Mieter widersprachen vehement und behaupteten, der Keller sei in Wahrheit eine dritte, eigenständige Wohnung. Damit wäre die erleichterte Kündigung unzulässig.
Alles hing also an der Frage: Ist der Keller nur ein Keller oder eine Wohnung? Um das zu klären, verließ sich das Gericht nicht auf Baupläne oder Genehmigungen. Entscheidend ist laut höchstrichterlicher Rechtsprechung die sogenannte Verkehrsanschauung. Das bedeutet: Wie würde ein objektiver Beobachter die Räumlichkeiten im Alltag bewerten? Eine Wohnung im rechtlichen Sinne ist eine Einheit von Räumen, die
- abgeschlossen ist,
- über die notwendigen sanitären Einrichtungen verfügt (Bad/WC),
- eine Kochgelegenheit hat oder zumindest deren Einrichtung ohne Weiteres erlaubt und
- somit die Führung eines eigenen, unabhängigen Haushalts ermöglicht.
Um diese Frage zu beantworten, ordnete das Gericht einen Ortstermin an. Die Richter besichtigten die Kellerräume persönlich und machten sich ein genaues Bild. Ihre Feststellungen waren eindeutig: Die Räume im Kellergeschoss waren weit mehr als ein typischer Keller. Sie stellten fest, dass die Einheit über einen eigenen Zugang vom Treppenhaus verfügte und die Fenster Tageslicht hereinließen. Es gab einen eigenen Sicherungskasten, und früher war sogar eine separate Klingel am Hauseingang vorhanden.
Im Inneren fanden die Richter wohnlich gestaltete Räume mit Raufasertapete, Heizkörpern und Bodenbelag vor. Entscheidend war die Ausstattung: In einem Raum befanden sich eine komplette Sanitäreinrichtung mit Dusche, Waschbecken und Toilette. In einem anderen Raum entdeckte das Gericht eine eingebaute Metalloberfläche mit Waschbecken und einer gefliesten Wandfläche, die typisch für die Installation einer Kochzeile ist. Alle notwendigen Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Strom waren vorhanden.
Die Einwände der Vermieterin, dass ein Raum als Durchgang zur Garage diene oder der Heizungskeller nur durch den Flur des Souterrains erreichbar sei, überzeugten das Gericht nicht. Diese Umstände heben den Charakter als eigenständige Wohneinheit nicht auf. Nach der umfassenden Prüfung kam das Gericht zu dem Schluss: Die Kellerräumlichkeiten erfüllen alle Kriterien einer eigenständigen Wohnung nach der Verkehrsanschauung. Damit befanden sich im Anwesen drei Wohnungen. Die Voraussetzung für die erleichterte Kündigung nach § 573a BGB war nicht erfüllt, und auch dieser letzte Versuch, das Mietverhältnis zu beenden, scheiterte. Da keine der Kündigungen wirksam war, bestand für die Mieter kein Grund zur Räumung. Die Klage der Vermieterin wurde vollständig abgewiesen.
Die Urteilslogik
Gerichte setzen dem Kündigungsrecht im Mietverhältnis klare Grenzen, indem sie auf Treu und Glauben, zeitnahes Handeln und die tatsächliche Beschaffenheit von Wohnraum achten.
- Fairness im Vertragsverhältnis: Vertragspartner handeln nach dem Grundsatz von Treu und Glauben, was bedeutet, einen formalen Rechtsanspruch nicht missbräuchlich auszunutzen, insbesondere wenn Missverständnisse durch einfache Kommunikation vermeidbar wären.
- Zeitliche Bindung des Kündigungsrechts: Wer ein schwerwiegendes Fehlverhalten monatelang duldet, verliert das Recht zur fristlosen Kündigung, da zeitnahes Handeln die Dringlichkeit der Vertragsbeendigung belegt.
- Definition von Wohnraum: Die Eigenschaft einer Räumlichkeit als eigenständige Wohnung bestimmt sich nach ihrer tatsächlichen Ausstattung und Nutzbarkeit für einen unabhängigen Haushalt gemäß der allgemeinen Verkehrsanschauung, unabhängig von Bauplänen oder behördlichen Genehmigungen.
Diese Prinzipien stellen sicher, dass Kündigungsrechte im Mietrecht nicht willkürlich ausgeübt werden können, sondern stets im Einklang mit den Geboten der Fairness und der tatsächlichen Gegebenheiten stehen.
Benötigen Sie Hilfe?
Müssen Sie sich gegen eine Kündigung Ihrer Mietwohnung im Zweifamilienhaus wehren? Erhalten Sie eine unverbindliche erste Einschätzung Ihrer Situation.
Das Urteil in der Praxis
Selten hat ein Gericht die Definition einer „Wohnung“ so plastisch seziert wie das Amtsgericht Gießen in diesem Fall. Dieses Urteil ist ein klares Signal an alle Vermieter, dass bei der Anwendung der erleichterten Kündigung nach § 573a BGB nicht nur die Bauakte zählt, sondern die gelebte Realität. Wer sich allein auf formale Genehmigungen verlässt, riskiert eine böse Überraschung, wenn der vermeintliche Keller plötzlich zur dritten Wohnung mutiert. Die Gerichte schauen genau hin, wie Räume tatsächlich genutzt werden können – ein entscheidender Faktor, der die strategische Planung von Kündigungen fundamental beeinflusst.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Warum scheitert meine Mietkündigung wegen Treu und Glauben?
Ihre Mietkündigung scheitert am Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB), wenn Ihr Verhalten nicht fair und anständig war, selbst wenn formale Regeln auf Ihrer Seite schienen. Juristen nennen dies rechtsmissbräuchliche Rechtsausübung; ein Gericht verbietet dann die Kündigung, um Vertrauensbruch zu verhindern. Die Idee dahinter: Verträge sind keine Falle, sondern basieren auf Fairness zwischen den Parteien.
Der Grundsatz ist eine Art moralischer Anker im deutschen Recht. Er verhindert, dass jemand seine Rechte formal gnadenlos durchsetzt, obwohl dies unredlich wäre. Stellen Sie sich vor, Sie lassen einen Mieter sehenden Auges in ein Missverständnis laufen, anstatt es mit einem klaren Wort zu klären. Genau das passierte im Fall des Amtsgerichts Gießen: Eine Vermieterin sah 16 Monate lang zu, wie vermeintliche Mietschulden aufliefen, die auf einer Unklarheit bezüglich der Nebenkosten beruhten.
Ein einfacher Hinweis hätte das Problem gelöst. Stattdessen wartete die Vermieterin ab, bis der Betrag eine fristlose Kündigung rechtfertigte. Das Gericht nannte das rechtsmissbräuchlich. Es ist unfair, auf eine Abmahnung zu verzichten, um dann mit einer Kündigung überraschen zu können. Die fristlose Kündigung wegen Mietrückständen war damit unwirksam.
Spielen Sie fair, sonst kippt ein Gericht Ihre Kündigung.
Kann mein Vermieter im Zweifamilienhaus ohne Grund kündigen?
Ja, Ihr Vermieter kann im Zweifamilienhaus ohne Grund kündigen, aber nur unter sehr engen Bedingungen. Diese erleichterte Kündigung nach § 573a BGB greift ausschließlich, wenn der Vermieter selbst im Gebäude wohnt und das Haus nach objektiver Bewertung tatsächlich nur zwei Wohnungen umfasst.
Das Gesetz macht hier klare Vorgaben: Die Sonderregel soll Vermietern in kleinen Häusern mehr Flexibilität geben, wo die Nähe zum Mieter eine Rolle spielt. Doch diese scheinbare Freiheit hat eine entscheidende Grenze. Die Richter prüfen die Anzahl der Wohnungen genau.
Im Fall vor dem Amtsgericht Gießen wollte eine Vermieterin kündigen, obwohl sie selbst im Haus lebte. Doch die Mieter blieben. Der Grund? Ein Keller, der nach juristischer Verkehrsanschauung eine dritte Wohnung darstellte. Die Richter besichtigten die Räume, fanden einen eigenen Zugang, ein Bad und sogar die Vorbereitung für eine Kochgelegenheit. So wurde der „Keller“ zur vollwertigen Wohnung, und die erleichterte Kündigung war vom Tisch.
Ein vermeintliches Zweifamilienhaus kann sich so schnell als Dreifamilienhaus entpuppen – die Kündigung ist dann unwirksam. Es geht nicht um Baupläne, sondern um die tatsächliche Nutzung. Prüfen Sie genau: Handelt es sich wirklich um ein echtes Zweifamilienhaus?
Muss mein Vermieter mich vor einer Kündigung abmahnen?
Ja, Ihr Vermieter muss Sie in vielen Fällen vor einer Kündigung abmahnen, besonders wenn es um mietvertragliche Pflichtverletzungen wie ausstehende Mietzahlungen geht. Vermieter sind verpflichtet, Mieter aktiv auf einen Verstoß hinzuweisen und ihnen eine Chance zur Korrektur zu geben. Ohne eine solche Abmahnung scheitert eine Räumungsklage vor Gericht oft kläglich.
Das Amtsgericht Gießen stellte genau dies kürzlich fest. Eine Vermieterin hatte langjährige Mieter wegen angeblicher Nebenkostenrückstände fristlos kündigen wollen. Sie wartete jedoch ganze 16 Monate, bis sich ein stattlicher Betrag angesammelt hatte, statt die Mieter umgehend über das vermeintliche Defizit zu informieren.
Gerichte nennen dieses Vorgehen einen Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB). Sie warfen der Vermieterin vor, die Mieter bewusst in einen Kündigungsgrund hineinlaufen lassen zu haben. Ein fairer Vertragspartner klärt Missverständnisse sofort. Diese unterbliebene Klarstellung – juristisch eine fehlende Abmahnung – führte dazu, dass die Kündigung wegen Zahlungsverzugs unwirksam war. Denken Sie an eine gelbe Karte im Fußball: Bevor der Schiedsrichter Rot zeigt, muss er verwarnen. Ein Vermieter muss dem Mieter die Möglichkeit einräumen, sein Fehlverhalten zu beseitigen. Nur dann kann eine spätere Kündigung wegen desselben Grundes rechtlich Bestand haben.
Achten Sie genau auf formelle Schritte Ihres Vermieters – das sichert Ihr Mietverhältnis.
Wann ist mein Kündigungsrecht als Vermieter verwirkt?
Ihr Kündigungsrecht als Vermieter kann tatsächlich verwirkt sein, wenn Sie nach Kenntnis eines Kündigungsgrundes zu lange mit der Kündigung warten. Das Amtsgericht Gießen zeigte kürzlich, wie fatal solch eine Verzögerung sein kann: Eine Vermieterin scheiterte mit ihrer Kündigung wegen angeblicher Bedrohungen, weil sie über sieben Monate verstreichen ließ. Wer bei einem schwerwiegenden Vorfall nicht zeitnah handelt, signalisiert damit, dass die Fortsetzung des Mietverhältnisses doch nicht unzumutbar war.
Der Grund? Das Gesetz macht klare Vorgaben: Ein Recht zur fristlosen Kündigung muss innerhalb einer angemessenen Frist ausgeübt werden, sobald der Kündigungsgrund bekannt ist (§ 314 Abs. 3 BGB). Wer ein Recht auf sofortige Beendigung eines Vertrags hat, muss dieses auch konsequent nutzen. Verzögerungen untergraben die Ernsthaftigkeit des Vorwurfs.
Das Amtsgericht Gießen führte diese Logik exemplarisch vor. Dort wartete die Vermieterin mehr als ein halbes Jahr nach den behaupteten Drohungen, bevor sie endlich kündigte. Für die Richter war diese Zeitspanne eindeutig zu lang. Sie ließen sogar offen, ob die Bedrohungen überhaupt stattgefunden hatten. Die Kündigung war allein wegen der späten Reaktion unwirksam. Diese Verzögerung war juristisch tödlich.
Handeln Sie bei Kündigungsgründen immer zeitnah – jeder Tag zählt!
Was tun, wenn mein Keller als dritte Wohnung gilt?
Gilt Ihr Keller als dritte Wohnung? Dann ist Vorsicht geboten! Die sogenannte erleichterte Kündigung nach § 573a BGB, mit der Sie Mietern im selben Haus ohne Grund kündigen könnten, ist schlicht unwirksam. Das bedeutet: Plötzlich gelten für Sie die deutlich strengeren, allgemeinen Kündigungsregeln des Mietrechts.
Warum das so ist, entscheidet nicht der Bauplan, sondern die sogenannte Verkehrsanschauung. Gerichte fragen: Kann dort ein unabhängiger Haushalt geführt werden? Eine Einheit muss dafür abgeschlossen sein, eigene sanitäre Einrichtungen wie Bad und WC besitzen und eine Kochgelegenheit ermöglichen. Sind diese Merkmale vorhanden, sieht das Gesetz den Keller als eigenständigen Wohnraum.
In einem aktuellen Fall besichtigten Richter Kellerräume persönlich. Dort fanden sie eine komplette Sanitäreinrichtung mit Dusche und WC. Auch eine vorbereitete Kochzeile mit allen Anschlüssen war vorhanden, ebenso Heizkörper, Bodenbelag und Tageslicht durch Fenster. Solche Details zählen. Sie machen aus einem Lagerraum eine vollwertige Wohneinheit. Dadurch steigt die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude, was die erleichterte Kündigung direkt aushebelt.
Prüfen Sie jeden Winkel Ihres Kellers, um unangenehme Überraschungen vor Gericht zu vermeiden.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Abmahnung
Eine Abmahnung ist eine offizielle Rüge für eine Vertragsverletzung, die dem Empfänger die Möglichkeit gibt, sein Verhalten zu ändern, bevor schwerwiegendere Konsequenzen wie eine Kündigung drohen. Juristen sehen sie als Warnschuss oder Mahnung. Das Gesetz verlangt oft eine Abmahnung, um den Vertragspartner vor einem schwerwiegenden Schritt zu schützen und ihm eine Chance zur Korrektur zu geben. Sie soll sicherstellen, dass Konflikte nicht eskalieren, ohne dass eine vorherige Kommunikation stattfand.
Beispiel: Eine fehlende Abmahnung der Vermieterin bezüglich der angeblich ausstehenden Nebenkosten trug maßgeblich dazu bei, dass das Amtsgericht Gießen ihre Kündigung wegen Mietschulden als unwirksam einstufte.
Erleichterte Kündigung (§ 573a BGB)
Die Erleichterte Kündigung nach § 573a BGB ermöglicht es einem Vermieter, der selbst im selben Haus wohnt, ein Mietverhältnis ohne die sonst nötigen Kündigungsgründe zu beenden, wenn das Gebäude nicht mehr als zwei Wohnungen hat. Diese Sonderregelung soll Vermietern in kleinen, persönlich geprägten Wohnverhältnissen eine höhere Flexibilität einräumen, da hier die direkte Nachbarschaft besondere Situationen schaffen kann, die eine Beendigung erleichtern. Das Gesetz berücksichtigt die räumliche Nähe.
Beispiel: Die Vermieterin im Fall des Amtsgerichts Gießen scheiterte mit ihrer erleichterten Kündigung, weil die Richter das Haus aufgrund der Beschaffenheit der Kellerräume nicht als Zweifamilienhaus, sondern als Gebäude mit drei Wohnungen bewerteten.
Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB)
Der Grundsatz von Treu und Glauben, festgeschrieben in § 242 BGB, verpflichtet alle Vertragsparteien zu Fairness und anständigem Verhalten im Rechtsverkehr und verhindert, dass formale Rechte missbräuchlich durchgesetzt werden. Diese fundamentale Rechtsnorm wirkt als Korrekturventil für starre gesetzliche Regeln und sorgt dafür, dass die Rechtsausübung nicht zu einem ungerechten oder unredlichen Ergebnis führt. Es ist ein moralischer Anker im deutschen Recht, der Vertrauen schützen soll.
Beispiel: Das Amtsgericht Gießen wandte den Grundsatz von Treu und Glauben an, als es der Vermieterin vorwarf, 16 Monate lang stillschweigend gewartet zu haben, anstatt die Mieter auf die vermeintlichen Nebenkostenrückstände hinzuweisen.
Verkehrsanschauung
Verkehrsanschauung beschreibt die objektive Bewertung einer Sachlage oder eines Gegenstands danach, wie ein vernünftiger Dritter die Situation im Alltag verstehen würde, unabhängig von formalen Bezeichnungen oder Absichten der Beteiligten. Diese richterliche Herangehensweise dient dazu, die tatsächlichen Gegebenheiten zu erfassen und zu vermeiden, dass rein formale Bezeichnungen von Räumen oder Gegenständen die Realität verzerren. Sie ermöglicht eine praxisnahe und gerechte Beurteilung von Sachverhalten.
Beispiel: Das Amtsgericht Gießen stützte seine Entscheidung, ob der Keller als dritte Wohnung zählt, maßgeblich auf die Verkehrsanschauung und prüfte vor Ort, ob die Räumlichkeiten tatsächlich einen unabhängigen Haushalt ermöglichen.
Verwirkt / Kündigungsrecht verwirkt
Ein Kündigungsrecht ist verwirkt, wenn der Berechtigte zu lange mit der Ausübung seines Rechts wartet und der andere Vertragspartner aufgrund dieses Untätigbleibens darauf vertrauen durfte, dass das Recht nicht mehr geltend gemacht wird. Dieses Prinzip schützt den Vertragspartner vor einer plötzlichen Geltendmachung von Rechten, die aufgrund einer langen Untätigkeit nicht mehr erwartet werden konnten. Es fördert Rechtssicherheit und verhindert, dass Kündigungsgründe „auf Vorrat“ gehalten werden. Das Gesetz verlangt bei schwerwiegenden Vertragsverstößen ein zeitnahes Handeln.
Beispiel: Die Kündigung der Vermieterin wegen angeblicher Bedrohungen war nach Ansicht des Amtsgerichts Gießen verwirkt, da zwischen dem Vorfall und der Kündigung mehr als sieben Monate vergangen waren und keine plausible Erklärung für die Verzögerung vorlag.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB)
Dieser Grundsatz verlangt, dass sich Vertragspartner fair, ehrlich und rücksichtsvoll verhalten und ihre Rechte nicht missbräuchlich ausüben.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht sah es als unfair und missbräuchlich an, dass die Vermieterin über 16 Monate schwieg, obwohl sie wusste, dass die Mieter ein Missverständnis über die Miete hatten, um dann einen Kündigungsgrund aufzubauen.
- Erleichterte Kündigung für Vermieter im Zweifamilienhaus (§ 573a BGB)
Ein Vermieter, der selbst in einem Haus mit maximal zwei Wohnungen wohnt, kann einem Mieter kündigen, ohne einen besonderen Grund wie Eigenbedarf angeben zu müssen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Vermieterin wollte sich auf diese Regelung berufen, um die Mieter ohne Begründung zu kündigen, da sie selbst im Erdgeschoss wohnte.
- Wohnung nach Verkehrsanschauung
Was rechtlich als Wohnung zählt, bemisst sich danach, ob Räume objektiv betrachtet einen unabhängigen Haushalt mit eigener Kochgelegenheit und Sanitäranlagen ermöglichen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Diese Definition war entscheidend dafür, ob der Keller als dritte Wohnung zählte und damit die erleichterte Kündigung nach § 573a BGB unwirksam machte.
- Verwirkung des Kündigungsrechts (§ 314 Abs. 3 BGB analog)
Das Recht zur fristlosen Kündigung muss zeitnah ausgeübt werden, nachdem man von einem schwerwiegenden Vertragsverstoß erfahren hat, sonst geht es verloren.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Vermieterin wartete über sieben Monate nach den angeblichen Bedrohungen, was vom Gericht als zu lang angesehen wurde und die Kündigung unwirksam machte.
Das vorliegende Urteil
AG Gießen – Az.: 46 C 55/24 – Urteil vom 17.01.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.






