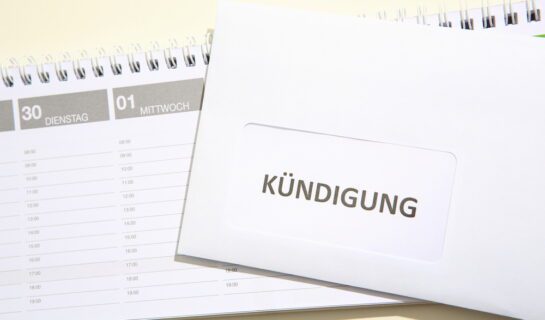Weil ihr Dachausbau nicht im Grundbuch stand, verlangten Wohnungseigentümer vor Gericht die Zustimmung ihrer Nachbarn und einen Streitwert von 395.000 Euro. Trotz dieser Forderung wurde der Wert des Streits letztlich auf nur 10.000 Euro festgesetzt – aus einem überraschenden Grund.
Übersicht
- Das Urteil in 30 Sekunden
- Die Fakten im Blick
- Der Fall vor Gericht
- Worum ging es bei dem Streit über den Dachgeschossausbau in einer Wohnungseigentümergemeinschaft?
- Warum landete der Fall über drei Gerichtsinstanzen hinweg?
- Weshalb stritten die Parteien über den Streitwert von 10.000 Euro gegenüber 395.000 Euro?
- Nach welchem Maßstab bewertete das Oberlandesgericht das wirtschaftliche Interesse der Kläger?
- Warum bestätigte das Oberlandesgericht die Festsetzung des Streitwerts auf 10.000 Euro?
- Die Urteilslogik
- Benötigen Sie Hilfe?
- Das Urteil in der Praxis
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil 32 W 925/25 WEG e | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Urteil in 30 Sekunden
- Das Problem: Ein Dachgeschossausbau war in den offiziellen Eigentumsdokumenten nicht vermerkt. Die neuen Eigentümer der ausgebauten Wohnung wollten dies ändern, doch die Nachbarn verweigerten ihre Zustimmung.
- Die Rechtsfrage: Nach welchem Maßstab bestimmt sich der Wert eines Rechtsstreits, wenn es um die Zustimmung zu einer solchen Änderung geht?
- Die Antwort: Ja, das Gericht bestätigte den niedrigeren Wert. Der Wert eines solchen Streits bemisst sich nicht nach dem Gesamtwert der Wohnung. Er orientiert sich nur am tatsächlichen Wertzuwachs, den die Änderung bringen würde.
- Die Bedeutung: Gerichts- und Anwaltskosten bei solchen Klagen richten sich nur nach dem konkreten finanziellen Vorteil. Der Gesamtwert einer Immobilie spielt dabei keine Rolle.
Die Fakten im Blick
- Gericht: Oberlandesgericht München
- Datum: 29.07.2025
- Aktenzeichen: 32 W 925/25 WEG e
- Verfahren: Beschwerdeverfahren
- Rechtsbereiche: Wohnungseigentumsrecht, Kostenrecht, Zivilprozessrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Miteigentümer von zwei Obergeschosswohnungen in einer dreiteiligen Wohnungseigentümergemeinschaft. Sie verlangten die gerichtliche Zustimmung der anderen Eigentümer zur Änderung der Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung wegen eines ausgebauten Dachgeschosses.
- Beklagte: Miteigentümer der Erdgeschosswohnung in derselben Wohnungseigentümergemeinschaft. Ihr Bevollmächtigter legte Beschwerde gegen die vom Landgericht festgesetzte Höhe des Streitwerts ein.
Worum ging es genau?
- Sachverhalt: Die Kläger begehrten die gerichtliche Zustimmung der Beklagten zur Änderung der Teilungserklärung wegen eines nachträglich ausgebauten Dachgeschosses. Das Landgericht lehnte dies ab und setzte einen Streitwert von 10.000,00 Euro fest.
Welche Rechtsfrage war entscheidend?
- Kernfrage: Durfte das Landgericht den Wert des Rechtsstreits für die Berufung auf 10.000 Euro festlegen, oder musste er viel höher sein, wie die Kläger meinten?
Entscheidung des Gerichts:
- Urteil im Ergebnis: Die Beschwerde des Bevollmächtigten der Beklagten gegen die Streitwertfestsetzung des Landgerichts wurde zurückgewiesen.
- Zentrale Begründung: Das wirtschaftliche Interesse bei Streitigkeiten über die Zustimmung zur Änderung einer Wohnungseigentümervereinbarung bemisst sich nach dem erwarteten Wertzuwachs der Wohnung und nicht nach deren vollem Verkehrswert.
- Konsequenzen für die Parteien: Die Streitwertfestsetzung des Landgerichts auf 10.000 Euro bleibt bestehen, und es entstehen keine weiteren Kosten für das Beschwerdeverfahren.
Der Fall vor Gericht
Worum ging es bei dem Streit über den Dachgeschossausbau in einer Wohnungseigentümergemeinschaft?
In einer kleinen Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) mit nur drei Parteien begann eine Auseinandersetzung, die sich um einen bereits vor Jahren vollzogenen Dachgeschossausbau drehte. Die Kläger, Eigentümer der beiden Obergeschosswohnungen, standen den Beklagten gegenüber, denen die Erdgeschosswohnung gehörte.

Der Kern des Problems lag in der Vergangenheit: Bereits im Jahr 2012, noch bevor die Kläger ihre Wohnungen 2016 erwarben, hatten die damaligen Eigentümer das Dachgeschoss zu Wohnzwecken ausgebaut. Mit schriftlicher Zustimmung der Beklagten wurde damals die Decke durchbrochen und eine Wendeltreppe installiert, um den neuen Wohnraum zu erschließen.
Obwohl diese bauliche Veränderung mit dem Segen der Nachbarn geschah, wurde ein entscheidender formeller Schritt versäumt. Die Teilungserklärung, das grundlegende Dokument einer jeden WEG, das festlegt, wem was gehört und wie die Miteigentumsanteile verteilt sind, wurde nie angepasst. Einfach ausgedrückt: Das Grundbuch spiegelte den tatsächlichen Zustand des Hauses nicht mehr wider. Zwar wurde 2019 ein notarieller Entwurf zur Änderung erstellt, doch der Weg ins Grundbuch fand er nie. Als die neuen Eigentümer diesen Zustand rechtlich heilen wollten, stießen sie auf Widerstand. Sie forderten von den Beklagten die Zustimmung zur Änderung der Teilungserklärung und der Gemeinschaftsordnung, um den Dachausbau offiziell zu machen. Doch die Beklagten verweigerten diese Zustimmung.
Warum landete der Fall über drei Gerichtsinstanzen hinweg?
Weil die Zustimmung der Nachbarn ausblieb, zogen die Eigentümer der Obergeschosswohnungen vor Gericht. Sie erhoben Klage beim Amtsgericht Freising, um die Beklagten zur Zustimmung zu zwingen. Ihr Antrag wurde jedoch abgewiesen. Unbeirrt legten die Kläger Berufung beim Landgericht München I ein. Sie verfolgten ihr Ziel weiter, die Teilungserklärung zu ändern. Doch auch das Landgericht wies ihre Berufung mit einem Beschluss zurück. Der Rechtsstreit in der Hauptsache war damit vorerst beendet.
Parallel zu dieser Entscheidung traf das Landgericht aber eine weitere, für die Kosten des Verfahrens entscheidende Festlegung: Es setzte den Streitwert für das Berufungsverfahren auf 10.000 Euro fest. Der Streitwert ist der in Geld ausgedrückte Wert des Klageziels und bildet die Grundlage für die Berechnung der Gerichts- und Anwaltsgebühren. Ein niedriger Streitwert bedeutet niedrige Kosten, ein hoher Streitwert entsprechend hohe. Genau an diesem Punkt entzündete sich ein neuer Konflikt. Sowohl der Anwalt der Kläger als auch der Anwalt der Beklagten legten, jeweils aus eigenem Recht, Beschwerde gegen diese Streitwertfestsetzung ein. Die Klägerseite hielt den Betrag für viel zu niedrig, während die Beklagtenseite die Berechnungsgrundlage des Gerichts ebenfalls rügte. Da das Landgericht bei seiner Entscheidung blieb, landete dieser Streit um den Streitwert schließlich in der nächsten Instanz, beim Oberlandesgericht München.
Weshalb stritten die Parteien über den Streitwert von 10.000 Euro gegenüber 395.000 Euro?
Die Klägerseite beantragte, den Streitwert auf 395.000 Euro festzusetzen. Ihre Argumentation war drastisch: Dieser Betrag entspreche dem vollen Verkehrswert ihrer Wohnung. Ohne die formelle Korrektur der Teilungserklärung sei ihre Immobilie praktisch nicht oder nur mit einem massiven Preisabschlag zu verkaufen. Ihr wirtschaftliches Interesse an der Klage, so die Kläger, sei daher nicht nur ein kleiner Vorteil, sondern der Wert der gesamten Wohnung, deren Veräußerbarkeit auf dem Spiel stehe. In ihrer Klageschrift hatten sie behauptet, die Wohnung sei ohne die begehrte Änderung schlicht unverkäuflich. Die von ihnen genannte Summe von 395.000 Euro sollte das Gericht als maßgeblichen Wert anerkennen.
Das Landgericht sah das völlig anders. Es suchte nach einem konkreten, greifbaren Anhaltspunkt für das tatsächliche wirtschaftliche Interesse der Kläger. Diesen Anhaltspunkt fand es in der Aussage eines Zeugen: des Voreigentümers der Wohnung. Dieser gab im Verfahren an, dass er den Klägern beim Verkauf im Jahr 2016 wegen der ungeklärten Grundbuchsituation einen Preisnachlass von 8.500 Euro auf den ursprünglich geforderten Kaufpreis gewährt hatte. Für das Landgericht war dies der entscheidende Beleg. Der finanzielle Nachteil, den die Kläger durch die fehlende Eintragung erlitten, war exakt bezifferbar. Ihr Interesse an einer Korrektur entsprach also diesem Betrag. Auf dieser Basis schätzte das Gericht den Streitwert großzügig auf 10.000 Euro. Es ging also um die Frage: Bemisst sich der Wert des Streits nach dem gesamten Wert der Immobilie (395.000 Euro) oder nur nach dem konkreten Wertzuwachs, den die Änderung mit sich bringen würde (8.500 Euro)?
Nach welchem Maßstab bewertete das Oberlandesgericht das wirtschaftliche Interesse der Kläger?
Das Oberlandesgericht München (OLG) musste nun klären, welche der beiden Sichtweisen rechtlich korrekt ist. Es stellte klar, dass der Maßstab für die Streitwertbemessung bei einer Klage auf Zustimmung zur Änderung einer Vereinbarung von Wohnungseigentümern strengen Regeln folgt. Entscheidend ist nicht der Wert der gesamten Sache, sondern der Wert des Vorteils, den der Kläger durch die begehrte Handlung erlangen will.
Die Richter griffen dabei auf eine etablierte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zurück. Wenn ein Wohnungseigentümer die Zustimmung zur Änderung der Teilungserklärung verlangt, bemisst sich sein wirtschaftliches Interesse nach dem erwarteten Wertzuwachs seiner Wohnung. Man kann sich das wie bei einem Auto vorstellen: Wenn man den Verkäufer eines Oldtimers verklagt, weil er einen zugesagten Originalmotor nicht einbaut, ist der Streitwert der Preis des Motors plus der damit verbundene Wertzuwachs des Autos – nicht der gesamte Wert des Oldtimers.
Das OLG wandte diesen Grundsatz auf den Fall an. Die Kläger wollten nicht ihre Wohnung an sich sichern, sondern deren Wert durch eine formale Korrektur steigern beziehungsweise einen vorhandenen Wertmangel beheben. Daher konnte der Streitwert nur dieser Differenz entsprechen. Der volle Verkehrswert der Wohnung wäre nur dann relevant, wenn es um etwas Existenzielleres ginge, zum Beispiel um eine Klage auf Entziehung des Wohnungseigentums. Da dies hier nicht der Fall war, war der Ansatz des Landgerichts, nur den Wertzuwachs zu betrachten, grundsätzlich richtig.
Das Gericht stützte sich dabei auf mehrere Rechtsnormen, die dieses Vorgehen vorschreiben:
- § 47 Abs. 1 GKG (Gerichtskostengesetz): Legt fest, dass sich der Streitwert in einem Rechtsmittelverfahren nach den Anträgen des Klägers und seinem wirtschaftlichen Interesse bemisst.
- § 10 Abs. 2 WEG (Wohnungseigentumsgesetz): Regelt den Anspruch auf Zustimmung zur Änderung von Vereinbarungen innerhalb der Eigentümergemeinschaft.
- § 3 ZPO (Zivilprozessordnung): Gibt dem Gericht die Befugnis, den Wert nach freiem Ermessen zu schätzen, wenn dieser nicht klar beziffert ist.
Zusammengefasst: Das OLG bestätigte, dass der Streitwert sich am konkreten, durch die Klage angestrebten Vermögensvorteil orientieren muss, nicht am Gesamtwert der betroffenen Sache.
Warum bestätigte das Oberlandesgericht die Festsetzung des Streitwerts auf 10.000 Euro?
Nachdem die rechtlichen Leitplanken gesetzt waren, prüfte das OLG die konkrete Schätzung des Landgerichts. Es kam zu dem Schluss, dass die Festsetzung auf 10.000 Euro nicht zu beanstanden war. Der Grund dafür lag in der soliden Beweislage. Die Aussage des Voreigentümers über den gewährten Kaufpreisabschlag von 8.500 Euro war für die Richter ein verlässlicher und greifbarer Anhaltspunkt. Sie spiegelte exakt den Betrag wider, den die ungeklärte Rechtslage die Kläger beim Erwerb gekostet hatte.
Das Gericht wies die Argumentation der Kläger, ihre Wohnung sei „unverkäuflich“, zurück. Diese Behauptung sei zwar eine starke Formulierung, aber rechtlich so zu interpretieren, dass ohne die Änderung eben nicht der volle Marktpreis erzielt werden könne. Die Differenz zwischen dem möglichen und dem tatsächlichen Preis war genau das, was es zu bewerten galt. Und für diese Differenz lag mit den 8.500 Euro eine konkrete Zahl auf dem Tisch. Da die Kläger keine anderen, überzeugenderen Beweise für einen höheren wirtschaftlichen Schaden vorgelegt hatten, durfte das Landgericht seine Schätzung auf diese Zeugenaussage stützen.
Die pauschale Angabe des Verkehrswertes von 395.000 Euro durch die Kläger war somit nicht maßgeblich. Zwar sind Wertangaben der Parteien ein wichtiger Hinweis, aber sie können durch konkrete Beweise wie eine Zeugenaussage widerlegt oder präzisiert werden. Da das Landgericht seine Schätzung nachvollziehbar auf diese konkrete Aussage gestützt hatte, sah das OLG keinen Grund, die Entscheidung zu korrigieren.
Die Beschwerde wurde daher zurückgewiesen. In der Sache entschied das Gericht zudem, dass für das Beschwerdeverfahren selbst keine Gerichtsgebühren anfallen und keine Kosten erstattet werden, wie es das Gesetz in solchen Fällen vorsieht. Der Streitwert für das Berufungsverfahren blieb damit bei 10.000 Euro.
Die Urteilslogik
Wenn Parteien den Wert eines Rechtsstreits anfechten, prüfen Gerichte genau, welchen konkreten Vorteil die Klage wirklich verschafft.
- Messlatte für Klagen: Der Streitwert einer Klage bestimmt sich nach dem konkreten wirtschaftlichen Vorteil, den eine Partei anstrebt, nicht nach dem Gesamtwert der betroffenen Sache.
- Interesse an WEG-Änderungen: Bei der Forderung nach Zustimmung zu einer Änderung der Wohnungseigentumsvereinbarung orientiert sich das wirtschaftliche Interesse des Klägers am erwarteten Wertzuwachs seiner Immobilie.
- Beweis für den Schaden: Gerichte schätzen den Streitwert auf Basis konkreter, bezifferbarer Nachteile und bevorzugen diese gegenüber pauschalen Behauptungen über den Gesamtwert einer Sache.
Die präzise Bestimmung des wirtschaftlichen Interesses bildet die unerlässliche Grundlage für eine gerechte Streitwertfestsetzung und die damit verbundenen Prozesskosten.
Benötigen Sie Hilfe?
Bestehen bei Ihnen Fragen zur Streitwertfestsetzung bei WEG-Änderungen? Erhalten Sie eine unverbindliche Ersteinschätzung Ihrer rechtlichen Situation.
Das Urteil in der Praxis
Für jeden, der vor Gericht seinen wirtschaftlichen Schaden beziffern muss, ist dieses Urteil ein Weckruf. Es zeigt unmissverständlich: Gerichte messen das wirtschaftliche Interesse nicht am Gesamtobjektwert, sondern am konkret bezifferbaren Vorteil oder Nachteil durch die begehrte Änderung. Wer auf formelle Korrektur pocht, muss seinen realen Wertzuwachs oder -verlust detailliert nachweisen, nicht den spekulativen Verkehrswert der gesamten Immobilie. Die Botschaft ist klar: Nur handfeste Belege zählen, nicht pauschale Behauptungen über die Unverkäuflichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Streitwert bei meiner WEG-Klage?
Der Streitwert Ihrer WEG-Klage beziffert das konkrete wirtschaftliche Interesse, das Sie mit Ihrem Rechtsstreit verfolgen – er ist die entscheidende Basis für die Berechnung der Gerichts- und Anwaltsgebühren. Ein kleiner Betrag hier kann hohe Kosten ersparen, ein hoher sie in die Höhe treiben. Dieser Wert ist niemals der volle Verkehrswert Ihrer Immobilie, sondern immer das unmittelbare Klageziel.
Warum ist das so wichtig? Gerichte bemessen den Aufwand eines Falls nicht am Immobilienwert, sondern am direkten Ziel der Klage. Juristen nennen das „wirtschaftliches Interesse“. Das bedeutet: Geht es beispielsweise um die Anpassung einer Teilungserklärung, zählt der erwartete Wertzuwachs Ihrer Wohnung, nicht ihr Gesamtwert.
Stellen Sie sich vor, Sie klagen wegen eines nachträglichen Dachausbaus. Ein Gericht bestätigte kürzlich: Entscheidend war nicht der Verkehrswert von 395.000 Euro, sondern ein nachweisbarer Wertabschlag von 8.500 Euro, den der Voreigentümer gewährt hatte. Das Gericht setzte den Streitwert deshalb auf 10.000 Euro fest. Klingt wenig? Für die Gebühren machte das einen Riesenunterschied.
Ein korrekt bezifferter Streitwert ist Ihr Fundament im WEG-Rechtsstreit – er entscheidet maßgeblich über Ihr finanzielles Risiko bei Gerichts- und Anwaltskosten.
Kann ich die Änderung meiner Teilungserklärung gerichtlich durchsetzen?
Ja, Sie können die Zustimmung zur Änderung Ihrer Teilungserklärung grundsätzlich gerichtlich durchsetzen. Allerdings ist der Erfolg alles andere als garantiert und hängt stark von den Umständen ab. Ein konkreter Fall zeigte, wie Kläger versuchten, die fehlende rechtliche Eintragung ihres Dachgeschossausbaus zu legalisieren, letztlich aber scheiterten.
Juristen nennen das einen Anspruch auf Zustimmung zur Änderung einer Vereinbarung. Doch Gerichte prüfen knallhart: Haben Sie wirklich ein berechtigtes Interesse an dieser Änderung? Es geht nicht um den Gesamtwert Ihrer Immobilie, sondern um den konkreten Vorteil, den die Änderung bringt.
Im besagten Fall über den Dachgeschossausbau scheiterten die Kläger, als sie die volle 395.000 Euro ihrer Wohnung als Streitwert anführten. Das Oberlandesgericht München machte klare Vorgaben: Entscheidend ist der tatsächliche Wertzuwachs. Weil der Voreigentümer einen Preisnachlass von 8.500 Euro gewährt hatte, taxierte das Gericht den Streitwert nur auf 10.000 Euro. Ihre Behauptung der „Unverkäuflichkeit“ allein reichte nicht.
Wollen Sie eine Teilungserklärung ändern, dokumentieren Sie Ihr berechtigtes Interesse akribisch – sonst bleiben die Gerichtskosten Ihr einziger Gewinn.
Gilt der volle Wohnungswert für meinen Streitwert?
Nein, der volle Wohnungswert ist für Ihren Streitwert bei einer Klage auf Zustimmung zur Änderung einer WEG-Vereinbarung meist irrelevant. Gerichte bemessen den Streitwert stattdessen am konkreten Wertzuwachs oder finanziellen Vorteil, den Sie durch die angestrebte Änderung Ihrer Immobilie erwarten. Es geht um den Wert des fehlenden Puzzleteils, nicht um den gesamten Wert des Puzzles.
Juristen nennen dieses Prinzip das „wirtschaftliche Interesse“. Ein OLG-Urteil aus München machte dies jüngst überdeutlich. Die Kläger wollten einen Dachausbau nachträglich in die Teilungserklärung eintragen lassen. Ohne diese formale Korrektur argumentierten sie, ihre 395.000 Euro teure Wohnung sei unverkäuflich. Doch die Richter folgten dieser Dramatisierung nicht.
Der Grund? Gerichte suchen nach dem messbaren Nutzen, den die Klage tatsächlich bringt. Im vorliegenden Fall hatte der Voreigentümer bereits 8.500 Euro Kaufpreisnachlass gewährt, weil die rechtliche Situation unklar war. Genau dieser konkrete Wertmangel, den die Klage beheben sollte, bildete für das Gericht die Basis. So wurde aus einem vermeintlichen Streitwert von 395.000 Euro, der den gesamten Verkehrswert der Wohnung repräsentierte, ein gerichtlicher Ansatz von lediglich 10.000 Euro. Das Gericht bestätigte: Entscheidend ist der spezifische Vorteil, den die begehrte Änderung für Ihre Immobilie schafft – nicht deren Gesamtwert.
Verstehen Sie: Gerichte bewerten Ihr konkretes wirtschaftliches Interesse, nicht den pauschalen Immobilienwert.
Wie lege ich Beschwerde gegen meinen Streitwert ein?
Will man den vom Gericht festgesetzten Streitwert anfechten, weil er zu hoch oder zu niedrig erscheint, ist eine Streitwertbeschwerde der Weg. Dieses Rechtsmittel, das direkt an das zuständige Gericht (oft das Land- oder Oberlandesgericht) gerichtet wird, ermöglicht es Ihnen, die Berechnungsgrundlage anzuprangern. Die Beschwerde ist entscheidend, da der Streitwert die Gerichts- und Anwaltskosten direkt beeinflusst.
Warum der ganze Aufwand? Der Streitwert ist die finanzielle Basis des gesamten Verfahrens. Juristen nennen das den „Gegenstandswert“, und er legt fest, wie viel Ihr Prozess Sie potenziell kostet. Ist der Wert zu hoch angesetzt, drohen überzogene Gebühren. Ist er zu niedrig, können Sie zwar sparen, doch eine spätere Korrektur nach oben kann teuer werden. Auch im vorliegenden Fall kämpften beide Parteien erbittert um die 10.000 Euro, weil die Kostenfrage so relevant ist.
Sie reichen die Streitwertbeschwerde formell beim Gericht ein, das den ursprünglichen Streitwert festgesetzt hat. Üblicherweise ist dies das Gericht der ersten Instanz oder das Berufungsgericht. Eine Frist von sechs Monaten nach Rechtskraft der Hauptsacheentscheidung oder der Wertfestsetzung müssen Sie hierbei einhalten. Beachten Sie: Ein Anwalt ist oft unerlässlich, um die juristischen Feinheiten der Wertfestsetzung zu beurteilen und die Beschwerde überzeugend zu begründen.
Prüfen Sie Erfolgsaussichten und das korrekte Verfahren stets mit einem spezialisierten Anwalt, um Kostenfallen bei der Streitwertfestsetzung zu vermeiden.
Reicht der volle Verkehrswert für meinen Streitwert aus?
Nein, die pauschale Angabe des vollen Verkehrswertes Ihrer Immobilie reicht für die Bemessung des Streitwerts meist nicht aus. Gerichte interessieren sich für Ihren konkreten finanziellen Vorteil oder Schaden, den die Klage tatsächlich beheben soll. Es geht nicht um den Gesamtwert der Sache, sondern um den durch die begehrte Handlung ausgelösten Wertzuwachs oder Wertabschlag.
Die Regel lautet: Juristen nennen das „wirtschaftliches Interesse“. Dieses misst sich am erwarteten Wertzuwachs Ihrer Wohnung, nicht an ihrem gesamten Wert. Ein aktuelles Urteil des Oberlandesgerichts München bestätigt dies eindrücklich. Dort forderten Kläger die Zustimmung zur Änderung einer Teilungserklärung, argumentierten, ihre Wohnung sei ohne Korrektur „unverkäuflich“ und verlangten einen Streitwert von 395.000 Euro, den Verkehrswert ihrer Immobilie.
Den Richtern genügte das nicht. Sie setzten den Streitwert auf lediglich 10.000 Euro fest. Der Grund? Eine konkrete Zeugenaussage belegte einen Preisnachlass von 8.500 Euro beim Kauf der Wohnung genau wegen der ungeklärten Rechtslage. Dieser konkrete Verlust, nicht der pauschale Verkehrswert der ganzen Immobilie, war für das Gericht entscheidend. Klingt nach einem Detail? Vor Gericht macht das den Unterschied.
Sammeln Sie konkrete Beweise wie Gutachten oder Belege für Wertabschläge, um Ihren tatsächlichen Schaden zu belegen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Streitwert
Der Streitwert bezeichnet den in Geld ausgedrückten Wert des Klageziels und bildet die maßgebliche Rechengrundlage für die Gerichtsgebühren und Anwaltskosten in einem Gerichtsverfahren. Dieses Konzept stellt sicher, dass die Kosten eines Rechtsstreits in einem angemessenen Verhältnis zum wirtschaftlichen Interesse der Parteien stehen. Juristen legen diesen Wert fest, um die finanzielle Last eines Prozesses transparent zu machen.
Beispiel: Für das Berufungsverfahren über den Dachgeschossausbau setzte das Landgericht einen Streitwert von 10.000 Euro fest, was von beiden Parteien angefochten wurde, da er direkte Auswirkungen auf die Prozesskosten hatte.
Streitwertbeschwerde
Eine Streitwertbeschwerde ist ein spezielles Rechtsmittel, um eine richterliche Festsetzung des Streitwerts gerichtlich überprüfen und gegebenenfalls korrigieren zu lassen. Dieses Rechtsmittel ermöglicht es den Parteien, die finanzielle Grundlage ihres Verfahrens anzufechten, wenn sie diese als unzutreffend oder zu hoch bzw. zu niedrig erachten. Das Gesetz gibt hier eine Möglichkeit, die Kostenbemessung zu kontrollieren.
Beispiel: Sowohl die Kläger- als auch die Beklagtenseite legten Streitwertbeschwerde gegen die vom Landgericht festgesetzten 10.000 Euro ein, weil sie unterschiedliche Ansichten über die korrekte Bewertung hatten.
Teilungserklärung
Die Teilungserklärung ist das notariell beurkundete Fundament einer Wohnungseigentümergemeinschaft, das genau festlegt, welche Teile eines Gebäudes Sondereigentum und welche Gemeinschaftseigentum sind, sowie die damit verbundenen Miteigentumsanteile und Sondernutzungsrechte. Dieses Dokument schafft die rechtliche Basis für das Zusammenleben in einer WEG und regelt die Rechte und Pflichten der einzelnen Eigentümer. Das Gesetz will dadurch Klarheit und Rechtssicherheit über die Eigentumsverhältnisse schaffen.
Beispiel: Im vorliegenden Fall wurde der Dachgeschossausbau zwar gebaut, aber die Teilungserklärung nie angepasst, was zu einem großen Rechtsstreit über die fehlende rechtliche Grundlage führte.
Verkehrswert
Der Verkehrswert, auch Marktwert genannt, ist der am Markt erzielbare Preis einer Immobilie, der sich aus dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage ergibt. Dieser Wert dient als wichtiger Anhaltspunkt für Verkäufe, Beleihungen oder Erbschaften, um den fairen Preis einer Sache objektiv zu bestimmen. Das Gesetz nutzt den Verkehrswert oft als Referenzgröße für wirtschaftliche Bewertungen.
Beispiel: Die Kläger forderten, den Streitwert auf Basis des Verkehrswertes ihrer Wohnung von 395.000 Euro festzusetzen, doch das Gericht lehnte dies ab und sah einen viel geringeren Wert als relevant an.
Wirtschaftliches Interesse
Das wirtschaftliche Interesse beziffert den konkreten finanziellen Nutzen oder Nachteil, den eine Partei durch ihren Klageantrag oder eine gerichtliche Entscheidung erlangen oder abwenden will. Juristen legen diesen Maßstab an, um den tatsächlichen Wert eines Rechtsstreits zu bemessen und überzogene oder unbegründete Forderungen zu vermeiden. Das Gericht konzentriert sich darauf, was der Kläger mit der Klage tatsächlich an materiellem Vorteil erzielen möchte.
Beispiel: Das Oberlandesgericht München urteilte, dass das wirtschaftliche Interesse der Kläger nicht im vollen Verkehrswert ihrer Wohnung lag, sondern im erwarteten Wertzuwachs durch die Änderung der Teilungserklärung.
Wichtige Rechtsgrundlagen
Streitwertbemessung nach dem wirtschaftlichen Interesse (§ 47 Abs. 1 GKG)
Der Wert eines Rechtsstreits bemisst sich nach dem konkreten finanziellen Vorteil, den die klagende Partei mit ihrer Klage erreichen möchte.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das OLG stellte klar, dass nicht der Gesamtwert der Wohnung, sondern nur der geschätzte Wertzuwachs maßgeblich für den Streitwert war, da die Kläger lediglich die Wertverbesserung ihrer Immobilie durch die formale Korrektur der Teilungserklärung anstrebten.
Gerichtliche Schätzung des Streitwerts (§ 3 ZPO)
Ist der Wert einer Klage nicht eindeutig in Geld bezifferbar, darf das Gericht diesen Wert nach freiem Ermessen und unter Berücksichtigung der bekannten Umstände schätzen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Landgericht und später das OLG nutzten diese Befugnis, um den Streitwert auf Basis des konkret bezifferbaren Preisnachlasses von 8.500 Euro zu schätzen, da dies den tatsächlichen wirtschaftlichen Nachteil der Kläger widerspiegelte.
Anspruch auf Zustimmung zur Änderung von Vereinbarungen (§ 10 Abs. 2 WEG)
Wohnungseigentümer können unter bestimmten Voraussetzungen von ihren Miteigentümern verlangen, dass sie einer Änderung bestehender Vereinbarungen zustimmen, wenn diese angemessen ist.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Kläger forderten auf dieser Rechtsgrundlage die Zustimmung der Beklagten zur Anpassung der Teilungserklärung, um den Dachausbau nachträglich rechtlich abzusichern.
Die Teilungserklärung (Grundlage des Wohnungseigentums)
Die Teilungserklärung ist ein notarielles Dokument, das die Aufteilung eines Gebäudes in einzelne Wohnungen und Gemeinschaftseigentum sowie die jeweiligen Eigentumsrechte und Pflichten festlegt.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Da die Teilungserklärung den bereits erfolgten Dachausbau nicht berücksichtigte, versuchten die Kläger, sie an den tatsächlichen Zustand anzupassen, um die Rechtssicherheit ihrer Wohnung herzustellen.
Das vorliegende Urteil
OLG München – Az.: 32 W 925/25 WEG e – Beschluss vom 29.07.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.